Wieder einmal wurde über die Ossis gesprochen. Der Chef des Axel-Springer-Verlages, Mathias Döpfner, sorgte für einen Eklat, als er die Ostdeutschen für demokratieunfähig erklärte und meinte, sie seien „entweder Faschisten oder Kommunisten“. Der sogenannte Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, schäumte vor Empörung und forderte seinen Rücktritt.
Verständlich, denn als Haupterzähler einer angeblich geglückten Wiedervereinigung darf von den mentalen Unterschieden der beiden deutschen Teile keine Rede sein. Döpfner hat die bittere Wahrheit auf den Tisch gelegt, denn so denkt man über uns Ostdeutsche. Damit können wir umgehen, das ist schließlich „nüscht Neues“. Die Aussagen brachten also Bestätigung und Ablehnung zugleich, denn der Riss zwischen Ost und West ist nach wie vor vorhanden, das beweist nicht nur der Blick auf die wirtschaftlichen Aspekte.
Der Riss ist immer noch vorhanden
Wie kann man dreißig Jahre nach der „Wiedervereinigung“ eine solche Aussage treffen? Das ist immer der Bezugspunkt, der gespannte Bogen. Der Beitritt des Gebietes der DDR zum Geltungsbereich der BRD war das Ergebnis eines jahrelangen Prozesses ökonomischer und politischer Entwicklungen in einer sich zunehmend globalisierenden Welt und die Proteste in der Endzeit der Utopie DDR das konstitutive Opfer für den zweiten (diesmal positiven) Gründungsmythos einer wiedergewonnenen, nun gemeinsamen Bundesrepublik. Nach außen also, das heißt politisch-medial westdeutsch, wurde neu gegründet, die Stimmung sorgte für ein großes Wir-Gefühl. Im Inneren dieses neuen Wir aber ereigneten sich vor allem Brüche und Tragödien im Großen wie im Kleinen.
Die neue Haupterzählung und ihre bonngrauen Protagonisten, die zum Teil als letzte auf den Zug aufgesprungen waren, kompensierten die großen Abbrüche mit Händeschütteln, Spatenstichen und Konsummöglichkeiten. Aufbruchstimmung, im positiven wie im negativen Sinne: die Wanderungen von Ost nach West, der Geburtenknick Anfang der 90er-Jahre, die Aufbauhelfer aus dem Westen, die neue Strukturen schufen, die Einbettung des Ostens in das antifaschistische Narrativ der BRD, die Privatisierung der Staatsbetriebe, die Arbeitslosigkeit. All diese Bewegungen waren Teil der Konsolidierung der Nachwendezeit.
Eine verpasste Chance
Hinzu kam, dass die Vertreter der DDR-Oppositionsbewegung des Neuen Forums keinen westlichen Liberalismus, sondern einen demokratischen Sozialismus im Sinn hatten. Die Machteliten des Westens hingegen brauchten neue Nachfrager für ihre Kapitalrenditen, ein weiterhin – in welcher Form auch immer – sozialistisches Land wäre als Absatzmarkt kaum geeignet gewesen. Die Profite waren wohl fest kalkuliert, die Opposition verstummte, stattdessen tauchten Figuren wie Gauck aus dem Unterholz auf. Heute, 30 Jahre später, ist diese Spaltung nicht verschwunden, im Gegenteil, sie hat sich im Zuge der „Konvergenz der Krisen“ (Benedikt Kaiser) der letzten Jahre bis heute vertieft.
Wenn Mathias Döpfer also sagt, der Osten sei nicht demokratiefähig, dann hat er aus westlicher Sicht sogar recht, denn der innere Riss, der von der Utopiezeit über die Nachwendezeit bis heute reicht, hat den Zweifel am großen Ganzen im Osten wachsen lassen und äußert sich bis heute in zahlreichen Widerstandsbewegungen, sei es Anfang der 90er-Jahre als Reaktion auf den Bau von Asylbewerberheimen, seien es die Pegida-Demonstrationen seit 2013 oder der Protest gegen das Hygieneregime der Corona-Zeit.
Der Sinn für die Normalität
Die „Gesellschaft des Spektakels“ (Guy Debord) verlangt Anpassung an das offizielle Programm, und der Ostdeutsche ist bei aller Geduld nicht bereit, jede Stufe der Absurdität zu erklimmen, er hat noch einen Sinn für Normalität und weiß sie notfalls zu verteidigen. Er weiß auch, dass er früher von Alten und Schwachen regiert wurde, heute aber von hinterhältigen Liberalen, die ihn kaufen, einspannen oder betäuben wollen. Der Ostdeutsche ist kein Liberaler, er ist aber auch kein klassischer Rechter oder Linker, er bezeichnet diese Einordnungen als anmaßend.
Er lehnt jede Zuschreibung von außen ab, ist ihrer überdrüssig, ignoriert sie einfach und wendet sich von den Wahrheitssystemen des tonangebenden Westens ab. Die äußere Demokratie, also jene, die sich ein Döpfner oder Gauck wünscht, in der man bitte auch die diskutablen Parteien wählt, lässt sich deshalb nicht herstellen, weil der Ostdeutsche zum einen kein Normalbürger ist wie der innerlich umerzogene Westdeutsche, sondern in erster Linie Sachse oder Thüringer, zum anderen wäre es eine Affirmation des freiheitlichen Systems, zu der der Ostdeutsche nur in einem Maße fähig ist, das ihn ehrt.
Döpfner ist nah an der Wahrheit
Döpfner erwähnt die AfD, die für ihn in einer Reihe mit Kaiser Wilhelm, Hitler und Honecker steht. Es fehlt nur noch Höcke als Ausdruck eines negativen Personenkults im bürgerlichen Establishment der Bundesrepublik. Dass die Partei der AfD in Thüringen bei 30 Prozent in den Umfragen liegt, kann nicht verstanden werden oder nur dahingehend interpretiert werden, dass es hier an demokratiebildendem Rüstzeug mangelt oder dass hier grundsätzlich feindselige Menschen leben, die nicht verstehen wollen oder können, dass auch ihre Zukunft bunt und weltoffen ist.
Der Osten ist damit die Negation des transantlantisch-liberalen Demokratieverständnisses und dieser Osten ist für den Axel-Springer-Liberalismus wohl verloren. Es darf nicht übersehen werden, dass die Ostdeutschen als gelernte DDR-Bürger ein Gespür für totalitäre Tendenzen und eine feine Sensorik für Anomalien von Maß und Mitte entwickelt haben.
Der Ossi wird bleiben
Nach all diesen Klarstellungen stellt sich nun die Frage, was sich ändert beziehungsweise ob und für wen die Aussagen relevant sind. Das Interesse von Springer liegt eindeutig bei den Zahlen und den Stakeholdern, Döpfner ist für den Konzern verantwortlich und ärgert sich, dass sein Angebot nach dreißig Jahren im Osten außer in den Ballungsräumen niemanden interessiert. Außerdem ist die Abwertung des sozialistischen Beitrittsbürgers ohnehin nie verschwunden, in den politischen Systemhäusern und Anstalten schon gar nicht.
Warum also auch einen Pfifferling darauf geben, dass hier mal wieder ein Wessi die Wahrheit gesagt hat, die Ossis das sowieso schon wissen und spüren und die große Erzählung vom vereinten Deutschland Teil des Spektakels ist. Ein Zusammenwachsen ist mit dieser Generation jedenfalls nicht mehr möglich, die nächste kann das vielleicht ganz unfreiwillig und gutwillig in dem Sinne ändern, dass die beiden deutschen Teile endgültig auseinander brechen und erst daraus geistige und politische Neuanfänge möglich werden.
Auf der anderen Seite, und dann betrachtet man die Dynamik im Lande überhaupt, läuft es wohl auf eine Fortsetzung des Spektakels hinaus, auf eine „Prolongation mit technischer Wiederaufbereitung“ (Botho Strauß), die einer inneren Demokratie, die die partikularen Identitäten des Ostens toleriert, im Wege steht.
Zur Person:
Kevin Naumann, Jahrgang 1988, ist ein Patriot aus Mitteldeutschland.
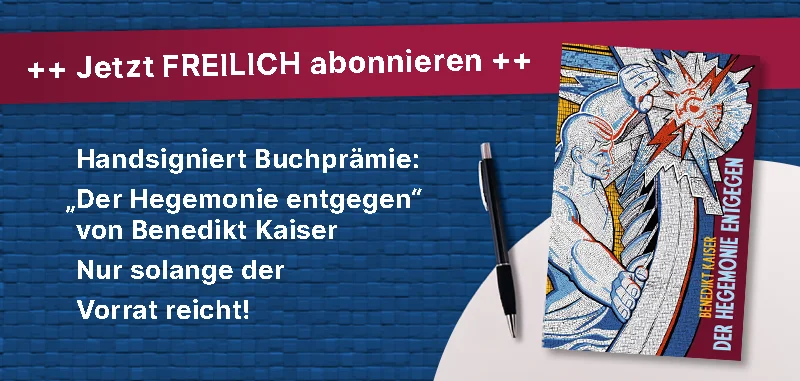





Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!