Mit dem neuesten Krieg in der Ukraine feiern besondere Gefühle überraschend ihre Rückkehr: Die Ästhetik der Beklemmung und das Gefühl der Apokalypse.
Ich bin ein Kind des Kalten Krieges. Genauer gesagt seiner Endphase, als Teil des „Orwell“-Jahrgangs – 1984. Obwohl ich die letzten sechs Jahre dieser globalen Epoche nur als Kind mitbekam, so prägten mich dennoch jene Erinnerungen so, wie die ersten Lebensjahre eines Kindes dieses nun einmal geprägt haben – eindringlich. Wenig rational, wenig reflektiert, aber sehr instinktiv, sehr emotional, sehr durch vielfältige, bruchstückhafte Sinneseindrücke geprägt, wie man sie aus seiner frühesten Kindheit ebenso mitnimmt. Die 80er Jahre waren für mich eben deswegen ein besonderes Jahrzehnt, weil ich sie erlebte mit Augen und Ohren, die noch sehr, sehr viel staunen konnten, die noch sehr beeindruckbar waren und die Eindrücke fasziniert, aber auf einer ganz anderen Ebene als heute aufsaugen konnten.
Ein Lebensgefühl kehrt zurück
Meine bruchstückhaften und meine präziseren Kindheitserinnerungen jener Zeit fusionierten später gewissermaßen mit meinem danach erworbenen schulischen, politischen und soziologischen Wissen über jene Zeit. Irgendwann erfuhr ich, was das war, was mich als Kind öfters samstagsmittags so beunruhigte, als die Luftschutz- bzw. ABC-Sirene ansprang und es zum regelmäßigen Test kam, der in der damaligen Zeit für uns alle normal war – und es wohl bald auch wieder werden wird. Und ich begriff, warum meine soziale Umwelt zur damaligen Zeit, wenn die Sirene ansprang, zwar beruhigende Worte sagte, aber dabei selbst instinktive, unwillkürliche Zeichen einer Beklemmung verriet, die von ganz tief drinnen kam. Später verstand ich, dass es die Angst war, die ganze Generationen geprägt hat, von den Hippies und 68ern bis zur Anti-Atomkraft- und Friedensbewegung der 80er Jahre. Die Angst nicht „nur“ vor Tod und Zerstörung, sondern vor noch schlimmerem. Vor Strahlung und Fallout, vor langem Leid. Entstellung. Chaos, Anarchie und Anomie. Vor Tod. Vor nuklearem Winter. Vor dem Ende von allem nach einer Phase unaussprechlichen Leids.
Diese Phase fiel zusammen mit Katastrophen wie Tschernobyl, einer Art Miniatur-Stellvertreterszenario für die ganz große Schreckensvision. Aber auch mit Seuchen wie AIDS. Das zugleich vollzog sich zeitgleich mit einem Zeitalter des hemmungslosen Hedonismus, wie ihn nur die 80er Jahre demonstrierten: Materialismus, Yuppies, überproduzierte Musik, Tonnen von Make-up und Haarspray. Wohl irgendwie so eine Art Kompensation der allgegenwärtigen Angst. Danach, ab den 90er Jahren, kam der allgemeine „Kater“ der Party-Dekade, die sich in der Grunge-Bewegung und allgemein vor sich her getragener Düsternis ausdrückte, was aber wohl gerade deswegen möglich und attraktiv war, weil man die tatsächliche Düsternis des Damoklesschwerts „Atomtod“ überwunden glaubte und in einem vermeintlich goldenen Zeitalter des liberalen „Endes der Geschichte“ angekommen zu sein schien. Man genoss sozusagen den Luxus, sich endlich etwas Pessimismus und melancholische Schwere erlauben zu können da, wo es nicht allzu wehtat – in der Musik und Kunst.
Ein goldenes Zeitalter
Ähnliche Ambivalenzen hatten bereits andere Dekaden präsentiert: In den 50er Jahren hörte man fröhlichen Rock and Roll und schaute unkomplizierte, witzige Heinz-Erhardt-Filme, weil man die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und die atomare Bedrohung des beginnenden Kalten Krieges einfach nur vergessen wollte. Kunst und Unterhaltung waren in der Geschichte des 20. Jahrhunderts immer wieder so etwas wie ein Blitzableiter und Kompensator des Politischen – und werden es wohl auch darüber hinaus bleiben.
Und trotz der Orgien-Dekade der 80s erlebte ich diese bereits damals instinktiv auch in ihren bedrohlichen Dimensionen. Von den Sirenen-Tests über das Auswechseln des Sandkasten-Sandes nach der radioaktiven Tschernobyl-Wolke über Europa im Jahre 1986, bis hin zu kleineren, geradezu winzigen emotionalen Facetten von Sinneseindrücken – die jetzt, mit Beginn des Ukraine-Krieges und seiner beträchtlichen globalen Umwälzungen, fast Flashback-ähnlich wieder hervorkamen.
Man liest Meldungen wie jene aus Mariupol, man hört Berichte über apokalyptische Meldungen aus dem unterirdischen Teil des Asow-Stahlwerks, diesem riesigen, zerstörten Industriekomplex, dessen Lebenswelt an nicht weniger als einer postatomare Hölle erinnert, die düsteren Science-Fiction-Dystopien entstammen könnte. Man sieht die Meldungen über Gefechte bei den AKWs Saporischschja und Tschernobyl, über die neuen alten Ängste von damals und heute, die diese wiedererweckt haben. Man assoziiert dieses berühmte Bild des toten Riesenrads in der verstrahlten Geisterstadt nahe dem AKW Tschernobyl. Man sieht diesen grauen Himmel über den alten kommunistischen Blockbauten der ukrainischen Städte, die man bereits früher im Fernsehen sah, als aus der Sowjetunion und später über die Wende berichtet wurde.
Die Rückkehr der Apokalypse
Bilder, die ich bruchstückhaft im Kopf habe und hatte, und die nun wieder aktiviert wurden. Ich weiß nicht, ob mein Kopf in dieser Hinsicht so funktioniert wie der anderer, aber: Für mich sind alle Lebensgefühle, alle Framings des Lebens immer auch assoziiert mit bestimmter Musik. Nicht immer ganz bestimmten Songs, aber bestimmten Musik-Genres.
Über die Gründe für die musikalischen Assoziationen in diesem Fall kann ich nur spekulieren. Möglicherweise liegt es daran, dass wir bei langen Autofahrten in Zeiten meiner Kindheit oft das Radio laufen hatten, und man dann die zeitgenössische Popmusik hörte, während man durch Kulissen von Industriegebieten und Kraftwerken im Ruhrgebiet oder in Frankreich fuhr und dabei Nachrichten über Atomkraft, Atomwaffen und Sowjetunion hörte. Man weiß es nicht. Aber: Müsste ich für jenes Lebensgefühl einen Soundtrack benennen, so wären dies Songs wie „Such A Shame“ von Talk Talk oder „Smalltown Boy“ von Bronski Beat, wohlwissend, dass sie textlich mitunter auch ganz andere Themen behandeln. Doch die Melodie, jenes Element, was – in diesem Fall weniger subtil – auch die gesellschaftskritischen Songs der Elektroband Kraftwerk („Radioaktivität“) ausmachte, ist für mich wie eine akustische Zusammenfassung jenes Lebensgefühls. Eine elektrische Welt, ein akustischer grauer Industriekomplex, der seine ganz eigene Ästhetik besitzt; eine Ästhetik des Bedroht-Seins und des Doch-einfach-nur-leben-Wollens. Eine Ästhetik der Beklemmung.
Ein neues Lebensgefühl?
Eine Welt, in der man unter dem Damokles-Schwert einfach weiterlebt, um sie wissend, aber sie kaum thematisierend; in der man mit der Bedrohung der Existenz der gesamten Menschheit oder zumindest der eigenen Hemisphäre so umgeht, als sei diese nur etwas Begleitendes, eine Kulisse, an die man sich hat gewöhnen müssen, der man im Zweifel niemals entkommen kann, die aber vielleicht auch nie mehr sein wird als eine Kulisse, als ein Spiel, auf das sich zwei Pole der Welt geeinigt haben und zwischen denen man irgendwie weiter lebt und weiter existiert. Zugleich eine Ästhetik, die wohl auch Bands wie Depeche Mode hervorbrachte, deren Melodien einem zuweilen scheinen wie ein musikalisches Bildnis des Asow-Stahlwerks.
Ein Lebensgefühl ist zurückgekehrt. Ein Lebensgefühl, von dem ich nie wirklich geglaubt hätte, dass ich es nochmal als Erwachsener erleben würde, dass es jemals nochmal so real werden würde und dass es meine memorialen Kindheitsbruchstücke nochmals so wie ein Puzzle zu einem großen Gesamtbild zusammenfügen würde. Und ein Gefühl, das ich wohl erst durch diese Rückkehr überhaupt wirklich als solches realisieren und benennen kann. Ein Lebensgefühl, das niemand wirklich zurückhaben wollte, welches aber nun mit größerer Macht zurückgekehrt ist, als es uns seit Jahrzehnten denkbar erschien. Such a shame.
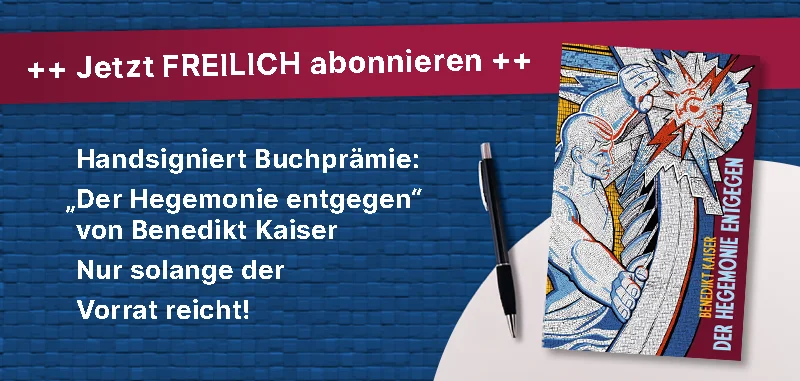

![Symbolbild: Pixabay [CC0]](https://img.freilich-magazin.com/-/article/plain/s3%3A%2F%2Ffreilich%2F2022%2F07%2FBeklemmung.jpg@webp)


Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!