Seit vielen Jahren hat kein Begriff in der deutschen Rechten eine schlechtere Karriere gemacht als der des „Vorfeldes“. Für viele AfD-Mitglieder erzeugt er inzwischen das Bild von unanständigen Bittstellern, die mit dem Bettelhut in der einen und einem Forderungskatalog in der anderen Hand an die Partei herantreten und dabei meinen, die höhere Moral für sich gepachtet zu haben, weil sie ja über der schmutzigen Parteipolitik stünden.
Dieses Bild ist, weiß Gott, nicht ganz unberechtigt! Wer unter dem Kampfschrei „Vorfeld, Vorfeld, Vorfeld“ meint, einer Partei qua höherer Heiligkeit dieses Vorfeldes von außen die Richtung vorschreiben zu können, braucht sich nicht zu wundern, daran erinnert zu werden: „Am Ende zählt die Zahl der Delegierten, nicht der Invektiven in Artikelchen.“ Deshalb ist es aus seiner Sicht ein sehr kluger Zug von Herrn Gottschalk, die von ihm mitzuverantwortende Säuberungswelle in der AfD-NRW über die Bande der Vorfeldschelte zu legitimieren. Den Respekt will ich ihm schon zollen, an dieser Stelle meinen Hut vor ihm zu ziehen.
Doch das Chaos der letzten Wochen und Monate hat ja wenig bis gar nichts mit dem Verhältnis zwischen der Partei und externen Gruppen und Akteuren des rechten Lagers zu tun. Tatsächlich zerlegt sich die Partei gerade wieder einmal intern und das sogenannte Vorfeld steht mit einer Mischung aus Hilflosigkeit, Wut und resigniertem Humor daneben. Die Ursache für die Krise ist dieselbe, wie in vergangenen gleichartigen Krisen, an denen die kurze Parteigeschichte der AfD übervoll ist: Es gibt innerhalb des liberalkonservativen Flügels seit Parteigründung Personen, deren Verständnis von innerparteilicher Demokratie besagt, dass eine Mehrheit von 60 Prozent zu 40 Prozent nicht etwa einen Führungsanspruch auf Zeit verleiht, sondern den Auftrag mittels des Parteiausschlussverfahrens aus einer sechzigprozentigen eine hundertprozentige Zustimmung zu ihrer eigenen Linie zu machen.
Die AfD ist keine homogene Partei
Die unvermeidliche Folge dieser Vorgehensweise ist, dass sie jeden Meinungsstreit existenziell auflädt. Delegiertenverteilung und Postenvergabe entscheiden nicht mehr zeitweilig über die Ausrichtung der Partei, sondern es droht jederzeit die politische Existenzvernichtung. Bei den Personen, die, was nach einer gewissen Zeit im politischen Geschäft für jeden unvermeidlich ist, der weder eine offengehaltene Beamtenstelle noch einen der freien Berufe in der Hinterhand hat, wirtschaftlich von der Partei abhängt, droht auch die ökonomische Existenzvernichtung. Dass bei solchen Zuständen die parteiinternen Kämpfe mit äußerster Bitterkeit geführt werden, lässt sich dann gar nicht mehr vermeiden.
Zu diesen ökonomisch Abhängigen gehören nun einmal auch Akteure des sogenannten Vorfeldes, die irgendwo als Mitarbeiter eines Abgeordneten ein Auskommen gefunden haben, weil die Partei nun einmal der einzige große Geldgeber innerhalb des rechten Lagers ist, doch dazu später mehr. Das Beste, was man noch zugunsten dieser liberalkonservativen Säuberer annehmen kann, ist, dass sie ernsthaft glauben, sie seien die Brandmauer gegen die wahren Extremisten. Die Folgen sind nur dieselben: Die sinnlose Eskalation interner Streitigkeiten, weil die Gegenseite natürlich reagieren muss. Es ist nur noch komisch, dass Personen, die so unfähig sind, interne Auseinandersetzungen zivilisiert zu führen, sich darüber beklagen, wenn sie einmal im Internet beschimpft werden.
Die Partei und ihre Mitarbeiter
Herr Gottschalk fordert nun, dass rechte Medien über diese Vorgänge nicht berichten sollen, oder doch zumindest keine Wertung vornehmen dürfen, wenn in seinem Landesverband solche Vorgehensweisen fröhliche Urstände feiern. Als Medien seien sie ja „Vorfeld“ und das Vorfeld habe sich aus den parteiinternen Konflikten herauszuhalten. Das ist nicht mehr, als ein rhetorischer Trick.
Man muss da einmal auseinandernehmen, was Herr Gottschalk hier alles unter „Vorfeld“ zusammenfasst. Wie gesagt, Gottschalk ist hier sehr geschickt. Er nutzt ausgezeichnet, dass über dieses Wort sehr unterschiedliche Arten von Akteuren in einen Topf geworfen werden.
Über die Medien haben wir schon gesprochen. Als Medien könnte Gottschalk ihnen schlecht vorwerfen, dass sie über die AfD berichten, als Teil des Vorfeldes kann Gottschalk ihnen ungebührliche Einmischung vorwerfen.
Dann sind da diejenigen, die sich selbst als „Vorfeld“ bezeichnen, die aber in irgendeiner Weise finanziell von der Partei leben. Leute, „deren Parteieintritt oftmals mit einem Jobantritt verbunden war oder sogar erst danach erfolgte“. Das sind vielfach Personen, die sich außerparteilich für Jahre politisch engagiert haben und die jetzt als Mitarbeiter eines Abgeordneten ein, wenn auch unsicheres, Auskommen gefunden haben. Dass diese Leute oft erst in die Partei eintraten, als sie begannen für einen Abgeordneten zu arbeiten, hat seinen Grund in derselben Säuberungslust, die Herr Gottschalk mit befördert. Selbst eine einfache Parteimitgliedschaft, ohne irgendwelche Ämter anzustreben, ist mit anderen öffentlichen Betätigungen schwer vereinbar; man riskiert schnell das Ausschlussverfahren; da treten viele lieber gar nicht erst ein, wenn sie es nicht müssen.
Geld bedeutet Macht
Gottschalk trifft genau den monetären Grund für die schwelenden Antipathien zwischen Partei und Vorfeld. Der ist ein Phänomen der Rechten, das auf der Linken so nicht existiert, auf der Rechten nur leider kaum aus der Welt zu schaffen ist. Der Grund ist dieser: Auf der Rechten ist die Partei die einzige Institution, die über nennenswerte Mittel verfügt. Das ist auf der Linken nicht so. Linke Akteure und Verbände finanzieren sich zwar auch ganz überwiegend über den Staat, nur da sie die Institutionen besetzen, stehen ihnen andere Geldquellen als die der Parteien zur Verfügung. Die beiden mit Abstand wichtigsten linken „Vorfeldorganisationen“ sind die Universitäten und der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Grüne Professoren und grüne Intendanten liegen dem Steuer-, respektive Rundfunkbeitragszahler auf der Tasche. Nicht der grünen Partei. Dasselbe gilt von Berufsantifanten, die aus den überfließenden Fördertöpfen zum Kampf gegen Rechts finanziert werden.
Die rechten Äquivalente können aber, wenn sie nicht außerordentlich geschickt im Spendensammeln sind, kaum anders finanziert werden als über die Partei. Die Partei ist nun einmal die einzige rechte Institution, der von Gesetzes wegen Steuergeldern zusteht. Alle anderen Verbände bekommen im Normalfall noch nicht einmal die Gemeinnützigkeit anerkannt. Das heißt, dass der Cent, der an einen Aktivisten, Medienmacher oder Intellektuellen fließt, einem verdienten Parteimitglied nicht zugutekommen kann. Daran lässt sich auf absehbare Zeit nichts ändern. Eine der vielen Hürden, mit denen das Kartellparteiensystem sich vor demokratischer Konkurrenz absichert, ist nun mal, dass Finanzfragen für diese Konkurrenz allzu oft ein konfliktträchtiges Nullsummenspiel sind, während das Kartell seine Unterstützer aus vielen Quellen mit Staatsgeldern versorgt. Man kann hier wenig mehr tun, als an Anstand und Fairness zu appellieren. Strukturell ist die finanzielle Reibungsfläche zwischen Partei und außerparteilich Akteuren nun einmal gegeben.
Die AfD hat kein Vorfeldproblem
Die letzte Kategorie von Akteuren, die unter Vorfeld zusammengefasst werden, sind alle möglichen Nutzer der Sozialen Medien. Von allen „Vorfeldakteuren“ ist das sicherlich die am wenigsten einheitliche Gruppe. Für sie gilt aber, dass sie sich im Falle, dass sich die AfD intern zerstreitet, im Schnitt eher auf die Seite desjenigen schlagen werden, der selbst einen guten Auftritt in den Sozialen Medien hat. Gute Arbeit in den Sozialen Medien ist damit ein Machtfaktor innerhalb der AfD. Dieser Machtfaktor verläuft quer zur offiziellen Parteihierarchie. Ein untergeordneter Funktionär kann eine Medienpräsenz haben, die weit über seinen Rang hinaus geht, was natürlich zu Reibungen mit Höhergestellten führen kann, die nicht über dasselbe Profil in der digitalen Öffentlichkeit verfügen.
Die Partei hat bis heute nicht wirklich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Nur lässt sich das Phänomen im Zeitalter der Sozialen Medien nicht abschaffen. Die Erwartung, dass X (ehemals Twitter) ruhig bleibt, wenn man den eigenen Spitzenkandidaten abschießt, ist bestenfalls naiv. Solche Aktionen bringen es mit sich, dass sich alle möglichen Leute gefragt oder ungefragt gegenseitig anschreien.
Die AfD hat kein Vorfeldproblem. Das Verhältnis der Partei zu manchen außerparteilichen Akteuren hat seine Reibungsflächen. Die Wichtigste davon, die finanzielle, habe ich oben skizziert. Aber das Verhältnis von „Partei und Vorfeld“ hat nichts mit den aktuellen Problemen zu tun. Die AfD streitet mal wieder intern, was schon aufgrund ihrer Größe auch die Parteiexternen hineinzieht. Personen, die in diesem Machtkampf zu den zweifelhaftesten Methoden greifen, haben es natürlich ungern, wenn das durch die Öffentlichkeit gezerrt wird.
Zur Person:
Johannes K. Poensgen, geboren 1992 in Aachen, studierte zwei Semester Rechtswissenschaft in Bayreuth, später Politikwissenschaft und Geschichte in Trier. Erreichte den Abschluss Bachelor of Arts mit einer Arbeit über die Krise der Staatsdogmatik im Deutschland des 20. Jahrhunderts. Befasste sich vor allem mit den Werken Oswald Spenglers und Carl Schmitts. Er bloggt auf seiner Netzseite „Fragen zur Zeit“.
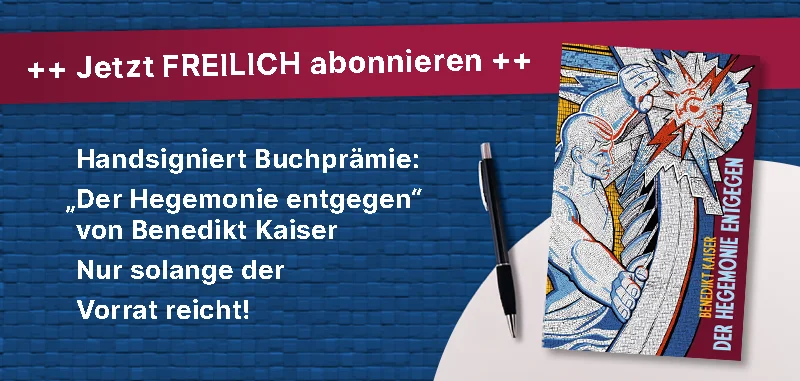




Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!