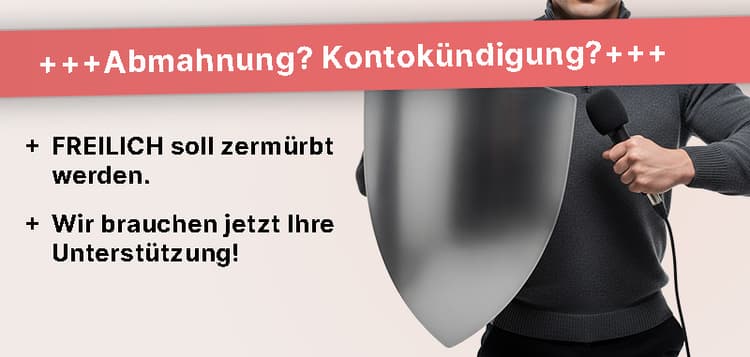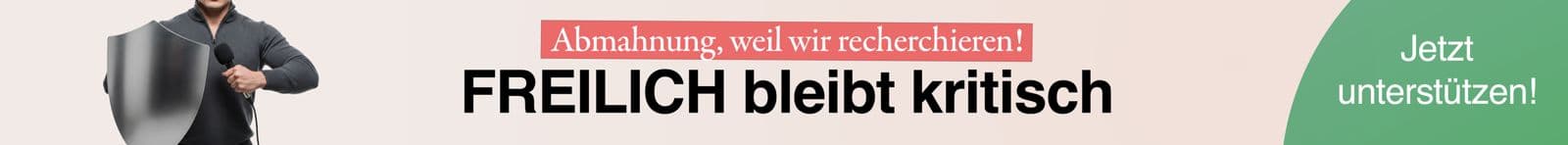Nach Mobbing und Druck: Aus für Islamismusforschung in Frankfurt
Das Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam muss schließen – nicht aus Geldmangel, sondern aufgrund ideologischer Grabenkämpfe und einer Kampagne gegen seine Leiterin, Susanne Schröter.
Für sie selbst sei das Ende des Zentrums kein Bruch, so Schröter, für die Forschung sei es allerdings bitter.
© IMAGO / Funke Foto ServicesFrankfurt. – Das Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam (FFGI) wird Ende September aufgelöst. Ursprünglich war geplant, dass das Institut auch nach dem Ruhestand seiner Leiterin Susanne Schröter bestehen bleibt. „Das war alles geregelt und in trockenen Tüchern“, erklärt Schröter in einem Interview mit Cicero. Doch ein Berufungsverfahren verlief anders als vorgesehen: „Am Ende wurde eine Mexiko-Spezialistin berufen und keine Person, die eine Islam-Expertise besaß. Damit war klar: Das Zentrum würde mit meiner Pensionierung aufgelöst werden.“

Kritik an postkolonialen Theorien
Für Schröter hat die Schließung auch politische Gründe. „Unsere Forschungen haben diese schlichte binäre Logik infrage gestellt“, sagt sie mit Blick auf die postkoloniale Theorie. Sie wirft dieser Denkrichtung vor, die Welt in Täter aus dem Westen und Opfer aus dem Nicht-Westen zu unterteilen. Besonders problematisch sei, dass Kritik an islamistischen Strömungen kaum Platz finde. „Muslime sind keine einheitliche Gruppe, und liberale Muslime sind oft die engagiertesten Kritiker der Fundamentalisten.“ Gerade diese Stimmen habe das Zentrum immer wieder eingeladen.
Prominente Kritiker als Gäste
Von Seyran Ateş über Ahmad Mansour bis hin zu internationalen Fachleuten – zahlreiche bekannte Persönlichkeiten hätten im FFGI ihre Positionen vorgestellt. „Die Resonanz in der Öffentlichkeit war enorm. Wir hatten volle Säle, Medienberichte in allen wichtigen Zeitungen und Fernsehanstalten, großes Interesse von Politikern und Praktikern.“
Der Erfolg habe jedoch auch Neid geweckt. „Einige Kollegen haben mir gegenüber beklagt, dass sie keine öffentliche Aufmerksamkeit erhalten, andere haben offenbar Pläne geschmiedet, um bei geeigneter Situation gegen mich vorzugehen.“
Vorwürfe und Kampagnen
Schröter schildert, dass ihre Veranstaltungen regelmäßig Proteste auslösten. Nach einer Konferenz über das Kopftuch 2019 sei ihr erstmals die Entlassung nahegelegt worden. Besonders eskalierte die Situation bei einer Tagung 2023: „Das Gebäude, in dem sie stattfand, wurde von Demonstranten umlagert – viele davon aus der Palästina-Szene, die uns wegen unserer Positionierung gegen jede Form des Antisemitismus ohnehin zu ihren persönlichen Hassobjekten auserkoren hatten.“
Dort sei es zu Beschimpfungen und Einschüchterungen gekommen. „Doch dann kam Palmer (Boris, OB Tübingen, Anm. d. Red.), allein und ohne sich angekündigt zu haben, lief den Demonstranten in die Arme und ließ sich zu einigen sehr ungeschickten Äußerungen provozieren, die mir angelastet wurden und die Steilvorlage für eine beispiellose Mobbingkampagne gegen mich lieferten.“
Geringe Unterstützung im Kollegium
Innerhalb der Universität habe Schröter wenig Rückhalt erfahren. Zwar habe sie im Alltag und im persönlichen Umgang „interessanterweise niemals“ Feindseligkeiten erlebt. „Aber wenn Kampagnen losgingen, waren plötzlich auch Kollegen dabei, die mir wenige Tage zuvor noch freundlich im Flur begegnet waren oder mit denen ich vollkommen normale Telefonate geführt hatte“. Unterstützung habe sie vor allem von außerhalb erhalten – aus Politik, Bürgerschaft und zivilgesellschaftlichen Organisationen.
Für die Beschäftigten bedeute die Schließung den Verlust ihrer Perspektiven. „Ein Kollege hat zwar eine Festanstellung an anderer Stelle, aber die meisten hatten nur befristete Verträge, wie es in der Wissenschaft üblich ist.“ Schröter sieht darin ein strukturelles Problem: „Kritische Islamforschung, insbesondere zu legalistischem Islamismus, ist an deutschen Universitäten kaum noch möglich.“ Auch Nachwuchswissenschaftler seien betroffen. „Wer nicht woke ist, macht keine Karriere.“
Wissenschaftsfreiheit unter Druck
Die Ethnologin spricht von einer zunehmenden Ideologisierung. „Tabus und Leitbilder haben sich etabliert, die kritische Forschung unmöglich machen.“ Förderorganisationen verlangten Konformität, abweichende Perspektiven hätten kaum Chancen. Als Gegenmodell nennt Schröter internationale Beispiele: „Österreich leistet sich seit Jahren eine ‚Dokumentationsstelle Politischer Islam‘. Dort entstehen Dossiers zu islamistischen Organisationen, hybriden Bedrohungen, extremistischen Ideologien. Deutschland, ein viel größeres Land, hat nichts Vergleichbares.“ Die Politik stimme ihr zwar zu, wenn sie eine ähnliche Einrichtung in Deutschland anrege, „aber es passiert einfach nichts“.
Für sie selbst sei das Ende des Zentrums kein Bruch. „Ich schreibe gerade ein neues Buch über die liberale Demokratie, halte weiterhin Vorträge und werde meine Beratungstätigkeiten ausbauen (...).“ Bitter sei das Aus jedoch für die Forschung: „Die Gesellschaft braucht offene Debatten und fundierte Expertise – auch zum Islam.“