Seitdem das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel aufhob, gehen die Wogen hoch. Dabei bilden sich vor allem zwei Lager, die allerdings beide am Ziel vorbei schießen. Weder sind alle Vermieter faule Hunde, die sich am einfachen Volk bereichern – noch regelt der freie Markt den grundlegenden Bedarf der Menschen, würdevoll zu leben, ordentlich. Der Schlüssel liegt vielmehr in städtischen Wohnbau-Konzepten.
Egal, wohin ich blicke, finde ich vor allem zwei Denkrichtungen. Die einen halten das Urteil für asozial und sehen eine Absolution für den galoppierenden Raubtierkapitalismus. Die anderen lachen über den gescheiterten angeblichen Versuch, kommunistische Enteignungsfantasien salonfähig zu machen, immerhin seien Vermieter ja auch Menschen. Beide Sichtweisen haben einen Ansatzpunkt – und beide Sichtweisen sind verkürzt. Draufzahlen muss so oder so der einfache Bürger.
Spekulation mit Wohnraum kein Kavaliersdelikt
Zuerst einmal gilt es festzuhalten: Jeder Bürger hat das Recht auf leistbaren Wohnraum. Und es ist ein absolutes Armutszeugnis, wenn die Miete so hoch ist, dass auch im Arbeiterbezirk in der Platte fast die Hälfte des Einkommens verschlingt. Ich wuchs in einer Stadt auf, die den höchsten Mietenspiegel in ganz Österreich hat, ich kann mich also gut in die Nöte der Berliner reinfühlen, wenn sie für eine kleine Garconniere hohe dreistellige Summen hinblättern müssen. Es fühlt sich wie moderne Sklaverei an, wenn trotz Vollzeitarbeit nach Fixkosten und Verpflegung kein Geld mehr übrig bleibt.
Und wer daraus ein Geschäft macht, der hat ein moralisches Problem. Dies tun auch tatsächlich einige Immobilienhaie. Und sich politisch auf die Seite großer Börsengesellschaften zu schlagen, die in einer Stadt über 100.000 Wohnungen besitzen, deren Preise sie nach Gutdünken in die Höhe treiben können ist kein Zeichen von Freiheitsliebe, sondern töricht. Gleichzeitig gibt es überall auch kleine Vermieter, die vielleicht ihre erste kleine Wohnung zwischennutzen lassen wollen, bis die Tochter alt genug ist, zu studieren. Diesen muss es auch möglich sein, diese instand halten zu können.
Berliner Wohnungsproblem ist hausgemacht
Der Mietendeckel, wie er in Berlin existierte, traf Letztere ebenfalls – und auch überhart. Zwar verloren die großen Wohnbaugesellschaften Abermillionen an Einnahmen – aber ihnen konnte das egal sein, sie kamen trotzdem durch. Im Gegenteil: Sie konnten nun erst recht nahe am Deckel auf Angebot und Nachfrage spielen und sich aussuchen, wer in die Wohnungen einzieht. Für kleine private Vermieter rentierte sich die Sache oft nicht mehr, sie mussten ihre Immobilien dem Markt entziehen.
Das Problem liegt nämlich woanders: Dieselben linken Parteien, die sich nun als Retter des einfachen Mannes aufspielten, schafften die prekäre Wohnsituation einst selbst. Bis vor wenigen Jahren nutzten sie jede Gelegenheit, um städtischen sozialen Wohnbau zum Schleuderpreis an große Gesellschaften zu verhökern. Die billigen Stadtwohnungen waren Mangelware – und dort wo sie noch existierten, gab es prekäre Verhältnisse, zumeist waren es ethnisch stark durchmischte Viertel samt aller Folgeprobleme. Viele einheimische Arbeiter mussten ins Umland ausweichen.
Wiener Gemeindebau als Vorzeigemodell
Dass und wie ein Mietendeckel funktionieren kann, zeigt hingegen Wien. Dort gibt es ihn ausschließlich im Gemeindebau. Das heißt: Im städtischen Altbau bleiben die Mieten stabil, bei Neubauten braucht es einen Anteil geförderter Wohnungen. Städtische Wohnungen schießen seit über hundert Jahren aus dem Boden wie Pilze. Ein großer Teil der Wiener lebt im „Gemeindebau“, genießt eigentumsähnliche Rechte und kann sich das Leben leisten. Für das „rote Wien“ war es auch dauerhafte Wählerbeschaffung.
Erst, als die Vergaberichtlinien so weit verdreht wurden, dass Migranten die Sozialwohnungen fluteten und Alt-Wiener oft durch die Finger schauten, änderte sich die Situation. Zeitweise war dann die FPÖ, die sich als „soziale Heimatpartei“ positionierte, in diesem Wählersegment sogar stärker als die Sozialdemokratie. Aber durch die politischen Lager gilt der Gemeindebau als Vorzeigemodell. Die Diskussion dreht sich nicht um das Ob, sondern das Wie. Wien wächst schneller als Berlin – und hat trotzdem erschwinglichere Wohnungen.
Sozialer Wohnbau ist Schlüssel zum Erfolg
Auch andere Städte, die wie Linz oder Graz traditionell auf sozialen Wohnbau setzen, haben einen relativ niedrigen Mietspiegel. In der Murmetropole finden sich vielerorts Wohnungspreise, die sich die Bewohner anderer Landeshauptstädte nur wünschen können. Durch eine Nachschärfung der Vergabe-Richtlinien, die Alteingesessene bevorzugen, wurde die Warteliste kürzer. FPÖ-Vizebürgermeister Mario Eustacchio, für das Wohnbau-Ressort zuständig, sprach 2018 davon, dass Grazer Familien nur ein halbes Jahr auf ihre geförderte Wohnung warten – drei Euro je Quadratmeter unter dem steirischen Richtwert.
In Linz klafft zwar eine Lücke zwischen den „besseren“ Vierteln und den „Problemvierteln“, in letzteren ist wie in Wien inzwischen der Migrantenanteil hoch. Allerdings sorgte die Politik auch dort vor. Dort besetzt ebenfalls ein Blauer das Ressort, Vizebürgermeister Markus Hein steht für ein solidarisch-patriotisches Programm. Das Linzer Modell sieht vor, dass Baugründe nur mehr umzuwidmen sind, wenn dabei zu einem Drittel geförderter Wohnraum entsteht. Städtisches Angebot, das vor allem die Alteingesessenen versorgt: Auch in der Stahlstadt ein Erfolgsmodell mit Weitblick.
Zuwanderung als Wurzel der Verknappung
In Salzburg und Innsbruck verdienen sich hingegen die Investoren eine goldene Nase. Gerade die Tiroler Landeshauptstadt hat die teuersten Mieten Österreichs. Die Stadtwohnungen sind ein recht rares Gut, gerade viele junge Innsbrucker stehen jahrelang auf der Warteliste. Als ich noch dort wohnte, waren es über vier Jahre – und das auch nur aufgrund eines Vorreihe-Kriteriums. Ein Familienmitglied, das als Frühpensionist nur die Mindestrente erhält, wartet seit über einem halben Jahrzehnt darauf. Auch für junge, einheimische Familien ist die Stadt damit weder attraktiv noch leistbar.
Dass die Stadt inmitten des Alpenherzes eine solche Wohnungsnot hat, hat mehrere Aspekte. Viele schieben es gerne auf die zahlreichen Studenten – aber auch die keuchen unter der Last des auf den freien Wohnungsmarkt ausgedehnten Verteilungskampf. Eine frühere Kommilitonin pendelte zeitweise täglich über zwei Stunden pro Richtung, weil sie keine leistbare Wohnung fand. Es ist aber auch nach Wien jene Landeshauptstadt mit dem zweithöchsten Migrantenanteil, er liegt jenseits der 30 Prozent. Wie in Berlin oder München kämpfen also einheimische und zugewanderte Arbeiter um den spärlichen städtischen Wohnraum. Die Immobilienspekulanten freut es – in beiden Ländern.
Strukturschwache Provinz, umkämpfte Stadt
Das Problem ist also vor allem der verknappte Wohnraum. Diesen verknappen gerade linke Parteien doppelt künstlich. Zum einen machen sie sich eben für den Zuzug von Migranten stark. Und zum anderen denken sie ihre Infrastruktur-Offensiven oft nur bis zur Stadtgrenze. Der ländliche Raum, sogar der Speckgürtel, ist ihnen suspektes, konservatives Hinterland. Er ist für sie – außer als späterer Zufluchtsort zur Aufzucht der Kinder fernab der von ihnen geschaffenen Großstadthölle – unattraktiv.
Als Resultat ist natürlich ein Argument von Liberalen, dass es ja irgendwo in der Lausitz billige Mieten hat. Es muss ja nicht jeder am Prenzlauer Berg leben. Freilich – aber man muss einem Fabrikarbeiter auch nicht zumuten, nach einer harten Schicht anderthalb Stunden im Auto zu sitzen. Man muss ihm entweder Arbeitsplätze in der Region schaffen – oder leistbares Wohnung in der Stadt ermöglichen. Und darum soll er sich nicht mit dem Prekariat aller Herren Länder balgen müssen. Tertium non datur.
Wohnraum gesamtheitlich und patriotisch denken
Dass die Episode in Berlin nun dazu führt, dass viele Berliner umso höhere Mieten haben als vor dem Deckel hat eine gewisse Tragikomik. Es zeigt sich, dass „gut gemeint“ oft das Gegenteil von gut ist. Es braucht ausreichend verfügbaren und erschwinglichen Wohnraum. Und das bedeutet, dass man diese Themen ganzheitlich denken muss.
Der ländliche Raum ist zu stärken, der soziale Wohnbau zu errichten und die Migration – als Mutter aller Probleme – einzuschränken. Gleichzeitig für leistbare Mieten und für #WirHabenPlatz einzustehen ist unmöglich. Europa ist nicht das Sozialamt der Welt und die dringend nötige Solidargemeinschaft steht und fällt mit der Begrenzung jener, die ihr angehören sollen.
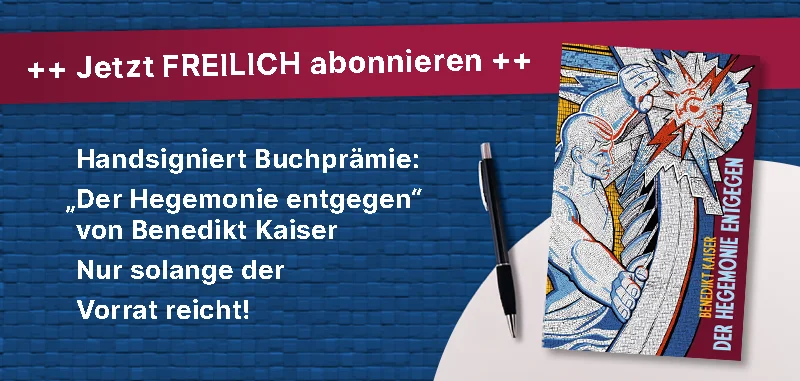


![Symbolbild (Gemeindebau in Wien): Häferl via Wikimedia Commons [CC BY-SA 3.0] (Bild zugeschnitten)](https://img.freilich-magazin.com/-/article/plain/s3%3A%2F%2Ffreilich%2F2021%2F04%2Fwien-gemeindebau-1200.jpg@webp)


Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!