Einmal traf ich Dostojewski in Berlin. Damals schien die Welt noch in Ordnung – vor dem Krieg, vor Covid. Anlass war eine Konferenz des Literaturkolloquiums über Osteuropa und Nordeurasien, mit einer Dichterlesung und anschließendem Podiumsgespräch. Man muss sich das in etwa so vorstellen: Eine feministische Dichterin aus der Tartarei tut sich mit poetischen Meisterwerken hervor vom Kaliber: „Mein Großvater schneidet dem Schaf die Kehle durch – es blutet so wie ich menstruiere.“ Danach poltert ein Ukrainer mit krimineller Visage seine kantige Lyrik, die vermutlich den Geist der Straße einfangen soll, und schließlich kommt der Meister. Groß, dunkel, mit Spitzbart und hoher Stirn, leise und prägnant, ein erzählerisches Talent.
Nach der Veranstaltung zieht es uns nach Charlottenburg, in eines der wenigen Lokale, die noch echte russische Küche bieten. Westliche Gerichte, abgesehen von Schweizer Käse, bekommt Dostojewski nicht. Berlin, so meinte er, sei ohnehin nicht seine Stadt. „Berlin ist wie die Berliner Weiße. Sauer, nur mit viel Saccharin erträglich“, lacht er.
Dostojewskis Eindrücke
Die deutsche Arbeitsmoral beeindruckt ihn, doch das utilitaristische Wesen des Westens ist ihm verhasst. Dostojewski spricht mit stockender Stimme, als ob jedes Wort durch eine innere Hürde gepresst werden muss. Nach jedem abgeschlossenen Satz verharrt er einen Moment, wie um einem lautlosen Echo nachzuhorchen. Sein Atem klingt schwer und gedämpft, als würde er durch eine dicke Schicht Stoff dringen. Dafür ist der deutsche Wodka umso mehr nach seinem Geschmack. „Wer nie besoffen ist, erkennt weder in sich selbst noch in anderen die Menschenwürde“, stellt der Klassiker fest, mit roten Wangen auf der Suche nach einem Taxi, mit einem Augenzwinkern, zugleich todernst. Ich sehe ihn noch winken, die schmale bärtige Gestalt, ein Charakter wie aus der Zeit gefallen. Neulich las ich ein Gedicht von ihm in einer obskuren literarischen Zeitschrift. Ein Schattenbild von Dostojewski, festgehalten im grünen Dunst eines Berliner Sommerabends, liegt auf meiner inneren Festplatte verborgen. Bei einer Spekulation auf hochvolatile Memcoins soll er vor Kurzem ein Vermögen verloren haben. Das Dasein als Literat in Russland gleicht einem Drahtseilakt. Autorenhonorare orientieren sich an der nominalen Auflage, doch wie viele Bücher wirklich gedruckt oder verkauft werden, bleibt oft ein Rätsel …
Flucht vor dem Joch des Kapitals
Mit dem Ausbruch des Krieges geriet mein Dostojewski unter die Räder der westlichen Unkultur der Absage. Er wird nicht mehr nach Berlin eingeladen. Durch seine Position auf den schwarzen Listen des russischen Staatsschutzes erhält er auch keine Unterstützung vom Präsidialamt, obwohl er auf der Website „Der Bürger“ die Doppelmoral des Westens anprangert und den Aufschwung des Patriotismus begrüßt. Für ihn stellt dieser Ausdruck des Volksgeistes eine Chance dar, dem geistigen Joch des Kapitals zu entkommen. „Der Krieg ist für die Massen ein Mittel, sich selbst zu respektieren, und deshalb lieben die Menschen den Krieg: Sie singen Lieder darüber und erzählen noch lange Legenden und Geschichten über ihn ... Vergossenes Blut hat eine besondere Bedeutung!“, bloggt er.
Beim Zuschauen erging es mir wie einem Gaffer bei einem Unfall: Man kann nicht wegsehen, obwohl man weiß, dass es schiefgehen wird. Die Serie stolpert über ihre eigenen Ambitionen, sowohl stilistisch als auch erzählerisch und konzeptionell.
Rodion Raskolnikow (Iwan Jankowski), ein mittelloser Student, plündert im Supermarkt Lebensmittel, während ein Teufel seinen Einkaufswagen schiebt. Eine solche düstere Figur existiert im Original nicht, im Film jedoch dient sie als platte Krücke, die an jeder Ecke auftaucht. Aber warum der Teufel? Warum nicht gleich Prometheus? Prometheus, der Titan des Widerstands, spiegelt Raskolnikows Wesen stärker wider als ein plumper Mephisto-Verschnitt. Dostojewskis Welt des Dämonischen funktioniert anders: Sie verläuft über psychische Abgründe und gesellschaftliche Zwänge, wie in der Novelle „Der Doppelgänger“ eindringlich gezeigt.
Auf der Bühne des „Swidrigailow“-Anwesens wird der Mephisto zur Rettung des Regisseurs selbst. Eine Szene, die einen gleichgeschlechtlichen Kuss vorsieht – ein Tabubruch angesichts der aktuellen russischen Gesetzgebung –, wird geschickt umgangen. Der Teufel persönlich greift ein und ersetzt eine der Frauen. Immerhin ist er vom erlaubten Geschlecht.
Die Darstellung der Figuren
In der neuen Serie von Wladimir Mirzoew scheint die Handlung in unserer Gegenwart zu spielen, doch die Figuren sprechen in einem Tonfall, der an das zaristische Russland erinnert: „Ihre Nerven sind verwöhnt wie die eines jungen Fräuleins!“ In meinem reaktionär-romantischen Weltbild kann ich diesem Dialogstil etwas abgewinnen. Doch das Geschehen bewegt sich in einer Art surrealen Sphäre, die der Regisseur selbst als „russisches Delirium“ bezeichnet.
Ein Zimmer wie ein Sarg. St. Petersburg windet sich durch seine eigenen Zeitschichten: Es scheint die Gegenwart zu sein, doch die Polizei findet den Mörder nicht mithilfe von Überwachungskameras, als wäre die Stadt noch die alte kaiserliche Hauptstadt oder Leningrad und nicht die heutige, hochvernetzte Smart City. Bordelle existieren offen, und Waffen sind leicht zugänglich – wie einst im freiheitsgesättigten Zarenreich. Ein klarer Affront gegen die heutige neopuritanische Autokratie, die so drückend und endlos erscheint wie jenes „Badehaus mit Spinnen“, in dem Swidrigailow seine Verdammnis erkennt. Ein Lichtblick bleibt: Die Ermittler werden als feinsinnige Intellektuelle dargestellt, keine stumpfen „Orkbullen“, wie man es sonst gewohnt ist.
Diese Mischung aus überzeichneten Elementen erinnert an die surrealen Welten von Twin Peaks, wobei die Hintergrundmusik stellenweise stark an die von Angelo Badalamenti erinnert – die Anlehnungen sind unübersehbar. Gleichzeitig verweist die Inszenierung auf die russische Tradition des Absurden, insbesondere auf Sergej Solowjew. Der Wahn tendiert ja dazu, das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen.
Holprige Erzählung
Bald wird deutlich, dass verschiedene Erzählstile in der Serie aufeinanderprallen. Ihre widersprüchlichen Muster kollidieren, was die Erzählung oft holprig erscheinen lässt und stellenweise ins Stocken bringt. Dennoch stützt sich die Serie in erster Linie auf die Darsteller, wodurch sie – trotz ambitionierter Ansätze – häufig auf dem Niveau eines experimentellen Videoprojekts verharrt. Diese stilistische Disharmonie spiegelt den inneren Konflikt des Regisseurs mit Dostojewski wider und lässt die Serie in eine Form ästhetischer Sabotage abgleiten. Mirzoew, ein überzeugter Liberaler, inszeniert dabei indirekt jene Qualen, die Dostojewski den russischen Liberalen in seinem Werk so unerbittlich zufügt.
„Wissen Sie, in den letzten drei Monaten habe ich Dostojewski erneut gelesen. Und ich empfinde einen beinahe körperlichen Hass auf diesen Mann. Er ist zweifellos ein Genie, aber seine Vorstellung von den Russen als auserwähltem, heiligem Volk, sein Kult des Leidens und die falschen Lösungsansätze, die er vorschlägt, treiben mich dazu, ihn in Stücke reißen zu wollen“, erklärte einst Anatolij Tschubajs, der liberale Politiker, der durch die Ausplünderung der russischen Wirtschaft bekannt wurde und inzwischen nach Israel geflohen ist, in einem Interview mit der Financial Times.
Ein ehrliches Scheitern
Das ehrliche Scheitern der Serie ist das Resultat eines Experiments zur Frage, inwiefern Dostojewski in die offene Gesellschaft hineinpasst. Das Experiment ist geglückt, das Ergebnis negativ.
Wo findet man heute noch einen Menschen, der so von Fragen der Sittlichkeit fasziniert ist – in einer Zeit, in der jede genderverwirrte Identität sich selbst als moralischen Maßstab begreift? Zeigen Sie mir jemanden, der so tief in den Menschen blickt, dass er darin eine unsterbliche Seele oder das Abbild Gottes zu erkennen versucht. Diese seine Geisteshaltung ließe sich leicht als pathologisch abtun – eine solche Deutung von Dostojewski war auf der Berliner Bühne schon öfter präsent. Oder aber als Propaganda: Immer wieder hat mich die Tatsache verblüfft, dass Goebbels Dostojewski als seinen Lieblingsautor angab. Es wäre interessant, „Schuld und Sühne“ einmal mit Goebbels' Augen zu lesen: „Hier steht ein junger Mann vor der entscheidenden Frage, ob er zu den Auserwählten gehört, die dazu bestimmt sind, der Menschheit das neue Gesetz zu bringen, das die Chimäre des Gewissens hinwegfegt. Oder ob er, ein zitterndes Geschöpf, an den schwächlichen Fesseln des Zweifels und der Zögerlichkeit hängen bleibt. Um diese Prüfung zu bestehen, entscheidet er sich für die endgültige Tat, die Vernichtung einer alten, wertlosen Wuchererin — es liegt auf der Hand, wer damit gemeint ist — die von der Ausbeutung des Volks lebt. Der Schritt ist hart, er ringt mit sich, doch der wahre Mann überwindet seine Zweifel und erhebt sich als Sieger. Am Ende ist es nicht nur sein eigener Wille, der ihn triumphieren lässt – Gott selbst verzeiht ihm und stellt sich ihm zur Seite, ebenso wie die ihn verehrende Frau. Es ist der unerschütterliche Sieg des wahren Volkes, der Familie und der staatlichen Ordnung.“
Dostojewski stand am Abgrund des Nihilismus, doch eine unsichtbare Kraft hielt ihn davor zurück, in die Leere zu stürzen. Wir hingegen – ob in Europa oder Russland – haben diesen Schritt längst gewagt. Haltlos gleiten wir durch die Leere, während der Boden unter uns zu einem unerreichbaren Schatten wird.
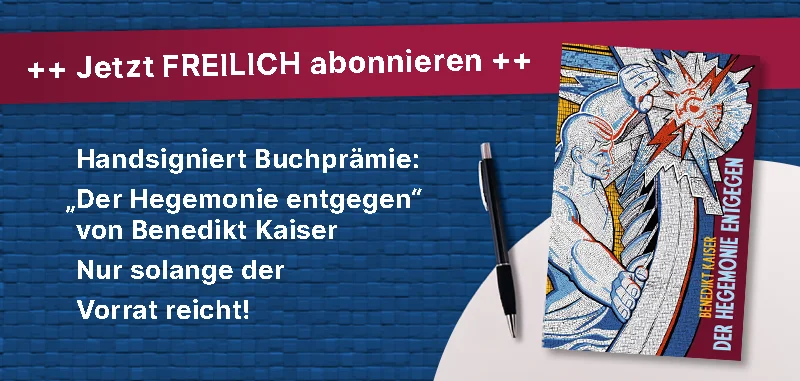





Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!