Die Marktlogik des liberal-kapitalistischen Systems ist kaputt und wird den Ansprüchen einer wahrhaft sozialen Marktwirtschaft nicht gerecht. Wie zur Zeit vor der solonischen Reform, als altgriechische Bauern durch aufstrebende Kaufleute von der eigenen Scholle in attische Bergwerke und die Schuldknechtschaft getrieben wurden, schuften immer weitere Teile des Volkes ihren Lebtag lang, nur um ohne nennenswertes Eigentum ins Grab zu gehen, während die Eliten ihr Vermögen und folglich ihre politische Macht auf geradezu oligarchische, kaum demokratisch legitimierte Weise mehren.
Festgefahrene Gedankenbilder aufbrechen
Das Verständnis dieser Problematik erklärt, wieso Wolters‘ Essay so wichtig ist: Die Produktionsmittel befinden sich in den Händen von „wenigen Falschen“, deren Interesse am Einbezug des Volkes in gesellschaftliche Teilhabe enden wollend ist. Das liberal-globalistische Weltwirtschaftsforum prophezeite einst zynisch: „You’ll own nothing and be happy.“ Das Vermögen jener, die durch ihr massives Eigentum zum „Stakeholder“ werden und auch Menschen und Ideen als frei zu vermarktendes Kapital begreifen, bleibt dabei unangetastet – ganz nach dem Prinzip „alter Wein in neuen Schläuchen“.
Die traditionelle Antwort der Rechten auf diese Frage ist allerdings reaktionär. Selbst eine sozialpatriotische Perspektive erschöpft sich oft in der emotional begreiflichen, aber etwas autistisch-schizophrenen Feststellung: „Eigentum ist Raub, Steuern auch“. Die Grundlage dieser Problematik liegt nicht zuletzt in der durch Vordenker wie den Engländer John Locke, den „Vater des Liberalismus“, verfassten Vorstellung von Eigentum als Naturrecht, wobei die wichtigste staatliche Aufgabe sei, dieses prinzipiell zu schützen. Wolters kritisiert diese Denke auf gleichsam elegante wie provokante Weise.
Historische Aufarbeitung als Stärke
Denn die Denkmuster sind lagerintern so festgefahren, dass der Autor nicht umhinkommt, in der Einleitung darauf zu verweisen, dass es eben genau nicht darum geht, Familien das Auto und Wohnhaus wegzunehmen, sondern insbesondere die Eigentumsverhältnisse der Produktionsmittel zu hinterfragen. Der Großteil des etwa 100 Seiten starken Buches besteht dabei aus fundierter historischer Analyse der Eigentumsordnung in Bezug auf die gesellschaftlich-wirtschaftlichen Verhältnisse und legt auch einen zentralen Fokus auf die philosophische Rezeptionsgeschichte.
Die diachrone Analyse nimmt den Ausgang nicht in der Jetztzeit, sondern der Antike und zieht sich über die Aufklärung bis zur Moderne. In der Herangehensweise erinnert das an die „Allgemeine Geschichte des Sozialismus und der sozialen Kämpfe“ von Max Beer, ist dabei aber konziser und vor allem stringenter – und nicht aus sozialistischer, sondern aus nationalkonservativ-sozialpatriotischer Perspektive. Dieser ideengeschichtliche Teil ist auch die große Stärke des Essays, obwohl er an diesem Punkt weitgehend ohne eigene Theorie auskommt und dennoch den Leser zu überzeugen weiß.
Mehr Einordnung hätte wohlgetan
In dieser Stärke liegt aber auch die größte Schwäche eines solchen Aufbaus: Die am Buchcover versprochene Einordnung nimmt mit Fortdauer zwar ständig größeren Raum ein, für die „Was tun?“-Gretchenfrage bleiben aber nur gut 25 Seiten am Ende. Natürlich kann auch ein Fußballmatch zu einem überzeugenden Sieg werden, wenn das erste Tor in der 70. Minute fällt. Aber man hätte schon früher deutlicheren Kommentar und den sprichwörtlichen „Zug zum Tor“ erwartet, sodass sich ausgerechnet zwei der zentralen Kritikpunkte am liberal-kapitalistisch-globalistischen Komplex und der Ausgestaltung seiner Eigentumsordnung nicht einmal im Lauftext, sondern den Endnoten Nr. 57 und 62 wiederfinden. Warum eigentlich?
Am deutlichsten wird diese Problematik bereits beim Kapitel über Locke: Zwar gelingt es Wolters schon in der Buchmitte, durch den Verweis auf Lockes Suffizienz- und Verderbnisklauseln den großen Denkfehler seiner radikalsten Jünger aufzuzeigen, die diesen gerne selektiv zitieren. Mehr Einordnung hätte trotzdem wohlgetan, um deutlich zu machen, dass sich selbst die hehren Vorstellungen einer „Selbstregulierung des Marktes“ durch menschliche Genügsamkeit statt Raffgier überholt haben. Das Paradoxon, dass selbst Locke die eigenen Jünger widerlegt, ließe sich genüsslicher in Szene setzen; erst recht, nachdem schon Tolstoi („Wie viel Erde braucht der Mensch?“) eine eindrucksvolle literarische Parabel dazu lieferte.
Gerechter Solon gegen die Gerechtigkeit?
Sobald Wolters seine theoretisch-strategischen Empfehlungen abgibt, bewahrheitet sich allerdings auch eine alte Weisheit: Ein guter Essay, dem man in großen Teilen zustimmen kann, ist nur dann wirklich provokant, wenn sich auch eine Stelle darin findet, bei der man den Drang verspüren kann, den Autor am Kragen zu packen und ihn in einem regelrechten Ohrschellengewitter zur Rede zu stellen, was er sich dabei wohl dachte. In Wolters‘ Fall ist es aus Sicht des Rezensenten die vollständige Überwindung des Konzeptes der sozialen Gerechtigkeit. Dieses bettet er verkürzt in historische Vorstellungen des linken und liberalen Lagers ein.
Er empfiehlt: „Rechte Perspektiven auf und Kritiken am Eigentum dürfen dementsprechend nicht den Fokus auf Gerechtigkeit legen und somit eine moralische Beliebigkeit riskieren, sondern müssen eine stabile und gute Ordnung anvisieren.“ Hier wird deutlich, dass er Solon zu hagiographisch zu einer Art „platonischer Philosophenkönig“ emporhebt. Zwar gab er dem Volk sein Land zurück und schaffte die elendige Schuldknechtschaft ab; er brach aber nicht systemisch mit der „Geld ist Macht“-Problematik. Immerhin sieht Wolters auch Solons „Reformer-Nachfolger“ Kleisthenes als Wegbereiter eines identitären althellenischen Patriotismus durch weitere Riegel gegen eine Eliten-Tyrannis.
Gefangen im „preußischen Gestell“
Die Problematik liegt hier im Ausbleiben der Frage, ob die linke Kritik nicht einfach „falsch befüllt“ sein könnte und der Überhöhung der „preußischen Ordnung“ nach Bismarck. Diese Frage hemmt die Rechte schon bei rechtsphilosophischen Fragen. Zurecht kritisiert man dort den allzu radikalen Kelsen-Rechtspositivismus, idolisiert aber die Schmitt’sche Lehre in Pausch und Bogen. Schon Heller und Radbruch gelten als geradezu radikal; zeitgenössische angelsächsische Naturrechtler werden als „liberale Beliebigkeit“ rezipiert, obwohl in Wahrheit ihr Missbrauch problematischer als ihr Ansatz ist.
Insofern ist die Debatte mit Wolters‘ Essay bei Weitem nicht abgeschlossen: Immerhin könnte es sich als zielführend erweisen, die Idee sozialer Gerechtigkeit nicht durch „stabile und gute Ordnung“ zu ersetzen, sondern damit zu vermählen und den Komplex um die aktuelle Beliebigkeit zu entschlacken. So machte gerade die Symbiose zwischen der teilweise vom „Gegner“ angelieferten Kritik und eigenen Konzepten den nachhaltigen Erfolg von Bismarcks Sozialgesetzgebung aus. Ohne den Gerechtigkeitsdiskurs zumindest in der Anamnese zu berücksichtigen, lässt sich dieser nämlich nicht begreifen.
Auch Wolters‘ Bezugnahme auf Sombarts Thesen in der Schnittmenge zwischen privatem und öffentlichem Eigentum, wo die Rückbesinnung aufs Heim im weiteren Gebilde eines „patriotischen Staatssozialismus“ die liberal-bürgerliche Eigentumsordnung zurückdrängt, ist für die Unvollständigkeit der Analyse, die dessen Frühwerk weitgehend ausspart, symptomatisch. Gerade vor dem Hintergrund, dass Sombart deutlich erkennbar als Stichwortgeber für Wolters‘ Zugang zur Eigentumsfrage auftritt, könnte die Abhandlung seiner ideengeschichtlichen Entwicklung gerne ausführlicher ausfallen.
Wichtige Debatte wurde angestoßen
Insgesamt schwächt das Buch ausgerechnet durch das fraglos ehrenwerte Bestreben, eine „genuin rechte“ Kritik an der Unzulänglichkeit bürgerlich-liberalen Eigentumsordnung zu postulieren, seine eigene starke Prämisse ab. Wolters zerhaut zunächst äußerst effektiv das dringend zu überwindende gedankliche Gefängnis des dualistischen Eigentumsdiskurses, wo eine Seite jede Form von privatem Eigentum als schändlich begreift, die andere jeden staatlichen Eingriff als marxistische Planwirtschaft darstellt – und das Resultat der Debatte dann ist, dass sich letztlich nichts an der bisherigen Ordnung ändert.
Zugleich errichtet es aber durch die vorschnelle, volle Abgrenzung von der Gerechtigkeitsfrage das Fundament für ein neues, gedankliches Gefängnis, das als volle Rezeptur für einen sozialpatriotischen Zugang zumindest in einigen Punkten zu kurz greift. Dennoch macht es als mutiger Beitrag zur lebendigen und unter Rechten zu oft tabuisierten Debatte einen unerlässlichen Anfang und ist somit geradezu Pflichtlektüre für jeden denkenden Rechten, der Interesse hat, den bürgerlich-liberalen Konsens nachhaltig aufzubrechen und per „Schwarmintelligenz“ ein solides rechtes Gegenmodell zu entwickeln.
Das Buch ist zum Preis von 14 Euro im Buchhandel oder direkt beim Verlag erhältlich.
Zur Person:
Der studierte Sprachwissenschafter wurde 1988 in Innsbruck geboren und lebte sieben Jahre in Großbritannien. Vor kurzem verlegte er seinen Lebensmittelpunkt ins malerische Innviertel, dessen Hügel, Wiesen und Wälder er gerne bewandert. Der Kenner alter Schriften und Kulturen schmökert leidenschaftlich in seiner ausgiebigen Bibliothek und ist passionierter Teetrinker und Käseliebhaber. Als ehemaliger Wachmann war der Freund harter Klänge schon immer um kein Wort verlegen. Seine Spezialität sind österreichische Innenpolitik sowie schonungsloser gesellschaftlicher Kommentar.
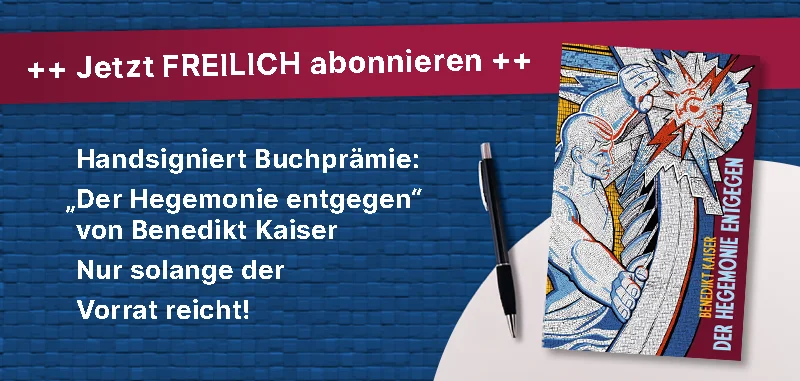


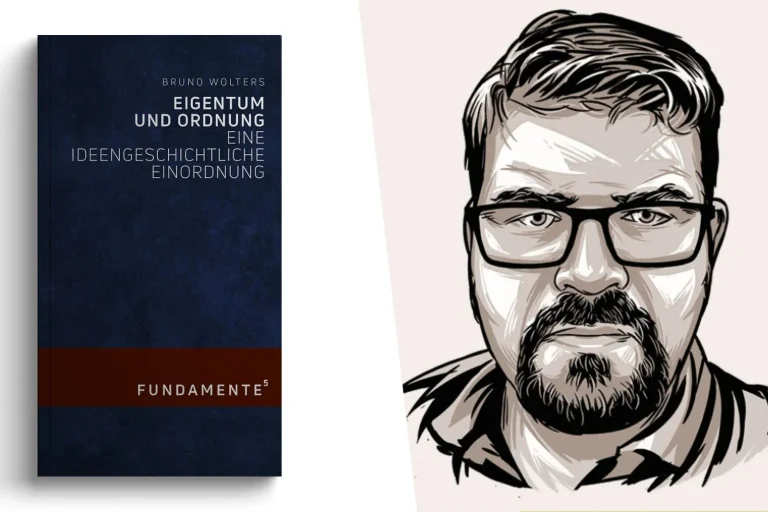


Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!