FREILICH: Im Juni startet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Freuen Sie sich schon darauf?
Günter Scholdt: Kaum. Nach Abschluss meines Buchs entfallen zwar obligatorische TV-Recherchen. Aber ich werde mir dennoch einige Spiele ansehen. Das durchideologisierte Fernsehe bietet ja kaum Unterhaltungsalternativen. Und beim Sport können unsere Gesinnungswächter wenigstens die Ergebnisse nicht manipulieren. Auch ist mein Fachinteresse daran noch nicht gänzlich erloschen. Fußball hat mich schließlich von Jugend an fasziniert – als jahrzehntelanger Amateurkicker, Vereinsfan, Spielertrainer und passionierter Anhänger der Nationalmannschaft. Allerdings hat die frühere Begeisterung durch drastische Verfallserscheinungen im modernen Sport stark gelitten.
Was hat Sie am Fußball so begeistert?
Fußball entspricht einem Urtrieb, der weltweit die Massen bezaubert. Er ähnelt antiken Dramen, in denen Heldentum aufleuchtet und vom Schicksal dazu Bestimmte jählings niedergeschmettert werden. Fußball ist, wo er sich von Exzessen fernhält und zivilisierende Regeln respektiert, eine ritualisierte, pazifizierte Form von Krieg oder Streit, dem nach Heraklit „Vater aller Dinge“.
Er entfesselt ein freiheitlich-alternatives Lebensgefühl echter Leistungsbewährung als Kontrast zum durch Intrigen und Kungeleien geprägten beruflichen wie gesellschaftlichen Alltag. Das aktuelle Wertegelaber der Politik, hinter dem sich vielfach nur Sprechverbote, Diffamierung und Verfolgung verbergen, bemäntelt doch nur, dass wir eine Sozialtugend verkümmern ließen: die Bereitschaft zum durch Regeln geordneten Streit mit offenem Visier. Den bietet Fußball, wo die „Wahrheit“ auf dem Platz liegt, konzentriert auf die alles entscheidende Frage: Tor oder Nicht-Tor.
In meiner Jugend hatte mich der Ballsport fest im Griff, zeitweise zu Lasten meiner Schulnoten. Später war ich immer mal wieder verantwortlich für den Aufbau bzw. die Weiterentwicklung verschiedener Mannschaften (in der Kreisklasse, Altherren- oder von Kollegenteams). Das vermittelte mir konkret, welche positiven Charaktereigenschaften Sport fördern kann und zu welchen Leistungssprüngen eine Mannschaft in der Lage ist, sobald sich aus bloß solipsistischen Spaßkickern durch Kameradschaft und Disziplin ein Kollektiv formt, das gleichwohl Einzelkönner nicht erdrückt. Solche gruppendynamischen Prozesse hautnah erlebt zu haben, werte ich heute noch als Glück und menschliche Bereicherung. Dabei lassen sich entsprechende Eindrücke in allen Niveaustufen gewinnen, auch jenseits spektakulärer tabellarischer Erfolge.
Haben Sie die letzte WM in Katar verfolgt oder, wie viele andere, boykottiert?
Ein Teil meines Bands besteht in Medienanalyse. Deshalb habe ich das Turnier sogar besonders intensiv beobachtet und reichlich Journalistenmüll protokolliert. Ohnehin erschien mir das flächendeckende Katar-Bashing als schizophrene Heuchelei. Zu Hause tat unsere politische Klasse nichts gegen Islamismusimport per Masseneinwanderung. Doch für die inneren Verhältnisse eines souveränen Staates fühlte sie sich hauptamtlich zuständig und entfesselte dabei selbst polemische Masseninstinkte, die man sonst in Bausch und Bogen verdammt. Auch mir missfällt weltweite Korruption bei solchen Anlässen. Doch war das zuvor je anders? Zudem bezweifle ich, dass ausgerechnet der DFB an der Spitze des Moralfeldzugs marschieren sollte, und halte es mehr mit Goethe: „Jeder kehre vor der eigenen Tür, und die Welt ist sauber.“
Im Problemkern erlebten wir doch das seltene Schauspiel, dass sich zwei der aggressivsten Globalagenden (die Regenbogen- wie die bedingungslose Immigrationslobby) einmal in die Quere kamen. Das hatte seinen eigenen diagnostischen Charme. Denn vor der Einigkeit solcher weltweiter Bedrückungszirkel ist mir viel banger.
Der Titel Ihres neuen Buchs lautet: „Fußball war unser Leben. Wie Kommerz und Politik die schönste Nebensache der Welt fast zerstörten.“ Woran denken Sie da konkret?
Bei Anlässen, die Milliarden in Taumel versetzen, wäre es naiv zu erwarten, dass ausgerechnet Geschäftsleute und Politiker die Chance versäumten, Fußball als Ware und Werbeplattform zu nutzen. Auch kann man in vielen Bereichen gewiss sinnvoll zusammenarbeiten. Ohne Würstchen- und Bierverkauf wäre so manches (von „Betonmischern“ und Langeweile bestimmte) Match kaum erträglich. Erst die Professionalisierung des Sports führte zu explosionsartigen Leistungssteigerungen und immer reizvolleren (inter-)nationalen Wettkämpfen.
Und wo der Staat durch Förderung besonders des Breitensports und den Bau von Hallen und Stadien der Volksgesundheit dient, mögen sich dessen oberste Repräsentanten dafür auch mal bei internationalen Siegen mitfeiern lassen, so unverdient solches Bad in der Menge meist auch sein dürfte. Viel schlimmer ist, dass sich die Dimension der Problematik erheblich verschoben hat durch Entwicklungen, welche die Beziehung zwischen Sport und Geschäft völlig pervertierten. Deren Weltstars „verdienen“ inzwischen teils ein bis zwei Millionen Euro pro Woche mit fatalen Folgen für die Finanzierung der Clubs. Globale Sportrechteverträge überschreiten die Staatsetats kleinerer Länder. Und die Spieleinflation in ständig vermehrten Wettbewerben gefährdet die Gesundheit der Akteure. Zudem ist Sport aktuell zu einer der wirksamsten Waffen der Postdemokratie geworden. Der Fußballhund wackelt also nicht mehr mit dem Kommerz- oder Politschwanz, sondern umgekehrt.
Aber lässt sich dieser Trend überhaupt aufhalten?
Meines Erachtens nicht. Bestenfalls kann man weitere Entartungen eine Weile hinauszögern, was besonders im Jugend- und Amateurbereich verdienstvoll wäre. Grundsätzlich scheint mir der Kommerzzug einer völlig ausgeuferten Sportvermarktung abgefahren zu sein. Insofern sind Ultras, wenn sie gegen „Plastikvereine“, Medienverträge oder Anderes (z. B. mit Tennisbällen und Schokoladetalern) zu Felde ziehen, im Kern vergangenheitsorientierte Romantiker. Sie berauschen sich an kleineren Protesterfolgen wie der Abschaffung des Montagsspiels. Doch sind das nur Brocken der Kommerzbeute, die man ihnen hinwirft, um sie bei Laune zu halten. Ihre eigentliche Funktion in hiesigen Stadien besteht in der militanten Mobilisierung gegen ein ominöses „Rechts“, wofür man sie reichlich füttert und auch asoziale Gewaltaktionen weitgehend durchwinkt oder nur verbal missbilligt.
Viel gravierender und gefährlicher als die pekuniären Verrücktheiten der Fußballbranche, die sich erst reguliert, wenn die Beutemacher völlig überdreht haben und ihre Ware ranzig wird, erscheint mir die massive Politisierung des Sports. Neigt er heute doch dazu, zugunsten eines woken Totalitarismus letzte Reste privater Unterhaltungsräume zu schließen und zu einem der wichtigsten Meinungsbeeinflussungsorte zu werden.
Fußball wird, wie Sie sagen, auch dazu genutzt, politische Botschaften zu verbreiten. Das tun Vereine, Spieler und Fans gleichermaßen. Gibt es eine besondere Verantwortung, um politische Statements zu setzen?
Klingt gut, wirkt sich aber selten so aus. Natürlich mögen sich Sportler oder deren Funktionäre wie andere Bürger auch, ihrem Wissen und ihrer Überzeugung gemäß, einbringen. Doch generell fragt sich, was diese Berufsgruppe so besonders für politische Äußerungen qualifiziert? Haben sie diesbezüglich überdurchschnittliche Kompetenz erlangt? Oder wird hier Prominenz missbraucht, die durch ganz andere Leistungen erworben wurde? Was förderungswürdige spezifische Werte wie Fairplay, Leistungsbereitschaft, Durchhaltewillen, Kameradschaft und Teamgeist betrifft gelten einige Sportgrößen zu Recht als Vorbilder und sind fraglos sachverständig. Doch um solche Tugenden geht es ja immer weniger zugunsten von Globalagenden, die mittels (partei-)politischer Unterwanderung der Verbände ihren Mitgliedern infiltriert werden.
In diesem Sinne werden Athleten vielfach wie Zirkuspferdchen geführt und müssen sich durch vorgegebene Stellungnahmen (von Corona über Klima bis zu bunten Armbinden) nolens volens als wandelnde Litfaßsäulen prostituieren. Um öffentliche Schelte zu vermeiden und Werbeverträge zu behalten, geben sie hübsch Pfötchen, wofür sie der Mainstream auch noch als Vorkämpfer für „Zivilcourage“ feiert. Ihre tatsächlichen Ansichten hingegen, sollten die mal abweichen, kümmern niemanden. Die wären dann Verstöße gegen allerlei schön klingende Verbands-„Werte“, hinter denen sich massive Interessen verbergen. Für politische Hintermänner respektive -frauen liegt darin ein effektiver Propagandagewinn. Denn ihr eigener Kredit sinkt ständig oder beschränkt ihre Agitation auf immer weniger besuchte Foren. Da passt es, dass ihre Ziele scheinbar objektiv andernorts vertreten werden.
Sie haben im Buch Beispiele von solchen „Globalagenden“ angeführt, darunter Kampf gegen „Rassismus“, fürs Klima, gegen sexuelle Diskriminierung, „Schutz vor Corona“ oder Unterstützung der Ukraine gegen einen militärischen Aggressor. Was spricht dagegen, sich dafür einzusetzen?
Gegen hehre Ziele wenig. Nur wird, wer dem folgt, meist Opfer systematischer Begriffsfälschungen. Die Tücke bei solchen „Werten“ liegt im Bedeutungswechsel unschuldiger Vokabeln zu Vorstellungen, die teils das Gegenteil besagen. Toleranz etwa hieß ursprünglich, Ungewohntes oder Ungeliebtes zu dulden. Heute beinhaltet es praktisch Zustimmungszwang zu vielem, was uns fremd erscheint, garniert durch eine administrative oder volkserzieherische Praxis nach der Devise: „Willst Du nicht meiner Meinung sein, so schlag ich dir den Schädel ein.“ Sportler werden so, wenn sie nicht als „rechtsextremistisch“ oder „Nazi“ diffamiert werden wollen, ein Bekenntnis gegen jede wirkliche Alternative deutscher Politik festgelegt. Sie haben sich gegen „Rassismus“ und für „Vielfalt“ zu positionieren, was praktisch Zustimmung zur uferlosen Masseneinwanderung aus aller Welt mit allen Gefahren für die innere Sicherheit heißt. Ein Ja zum regierungsamtlichen Corona-„Schutz“ bedeutete seinerzeit, einen Kurs zu propagieren, der heute bereits in wichtigen Punkten selbst von Regierungsverantwortlichen als überflüssig oder schädlich betrachtet wird. Per Regenbogenbinden für LGBTQ zu werben, heißt unter Umständen, durch sexualpolitische Manipulation von der Kita an fürchterliche Kindertragödien mitzuverantworten. Ins sportpolitisch unterfütterte Bekenntnis zur Klimaneutralität fließt Kritiklosigkeit ein gegenüber einer Agenda, die sich militant gegen wissenschaftlichen Zweifel abschottet, während die finanziellen Folgen sich in Dimensionen von Billionen Euro- oder Dollarbeträgen bewegen. „Weltoffen“ tendiert zur Gleichgültigkeit gegenüber nationalen Interessen und heimatlichen Bezügen. Das in Stadien choreografierte Peace-Zeichen steht für alternativlos erklärte Waffenlieferungen in Krisengebiete, was jahrzehntelang hierzulande politisch tabuisiert war. Die bedingungslos geforderte humanitäre Solidarität mit der attackierten Ukraine verwirklicht sich nicht ganz so einfach, wie dies im Nachbeten der Formel vom „völkerrechtswidrigen Angriffskrieg“ zum Ausdruck kommt. Denn die Eskalation ins Militärische wäre mit ein wenig besserem Willen beider Seiten vermeidbar gewesen. Und es steht zu befürchten, dass jeder zusätzliche Tag eines kaum zu gewinnenden Kriegs nur weitere ruinöse menschliche und ökonomische Verluste nach sich zieht. Kurz: Agenden propagieren Halbwahrheiten, d. h. Halbe Lügen, die oft dazu tendieren, ganze zu werden. Und diese ideellen Mogelpackungen sollen uns prominente Sportler schmackhaft machen.
Sie überschreiben das Kapitel zu einer weiteren Agenda: „Überprivilegierte jammern: Der gehypte Frauenfußball“. Stört Sie, dass auch Frauen kicken?
Ganz und gar nicht. Eine meiner Enkelinnen spielt Fußball, eine andere Handball. Und wohnte ich in der Nähe, würde ich mit Vergnügen beiden zusehen, wie früher meinem Sohn. Auch dass Frauen ihr Hobby mittlerweile als Beruf betreiben und sich bestens dafür bezahlen lassen können, finde ich okay. Mich stört nur, das Ganze unter dem Signum eines Freiheitsprojekts laufen zu lassen und die Umwelt quasi moralisch zu nötigen, sich dem periodisch auszusetzen.
Mehr noch: andere zwangsweise dafür löhnen zu lassen, die dem so viel abgewinnen können wie Schlammringen in St. Pauli. Die Forderung nach „Equal Pay“, ein gesellschaftlicher oder gar juristischer Anspruch, in bestimmter Höhe entlohnt zu werden, ist keine Angelegenheit der Gerechtigkeit, sondern eine von Angebot und Nachfrage. Es hat offenbar gehaltsrelevante Gründe, warum weltweit Milliarden lieber Real Madrids oder Bayern Münchens Männermannschaft schauen möchten als die Frauenelf von Wolfsburg, St. Pölten oder Chelsea. Wo Sportlerinnen bestimmte Gehälter oder Frauen Rechte auf Verbandsämter beanspruchen, befördern sie kein Freiheitsprojekt, sondern bedienen sich krasser Formen von Abzocke und Lobbyismus.
Inzwischen wird auf etlichen Sendern immer mehr Frauenfußball gezeigt. Offenbar lohnt es sich doch.
Der wird jedoch direkt oder indirekt aus öffentlichen wie privaten Geldtöpfen mit außerordentlichen Summen gesponsert. Wo als Maßstab wirklichen Interesses eher der Zuschauerzuspruch gilt, sieht die Bilanz ernüchternd aus. Die Durchschnittszahlen der Frauen-Bundesliga liegen ähnlich wie in Frankreich nämlich nur wenig über Tausend. Alle ihre 264 Partien zusammen zogen 2022/23 gerade mal 359.428 Zuschauer an. Bei den Männern waren es 37 mal mehr. Ein einziger Drittligist wie Dynamo Dresden verkaufte für die Heimspiele mehr Tickets als die ganze Frauenliga, deren Etats durch Männerabteilungen zwangsweise ausgeglichen werden. Gleichwohl beklagen Frauen Gehaltsdifferenzen gegenüber Männern, vertreten durch hunderte bestens vernetzter Lobbyistinnen, die in einem kaum durchdringlichen Dschungel in Politik und Medien agieren. Dabei liefe, wo tatsächlich Gleichheitsdogmen praktiziert würden, das Ganze auf massive Nivellierung aktueller Spielerinneneinkünfte nach unten hinaus. Denn gegenüber fast allen anderen Sportarten, die wahrlich nicht weniger leisten, sind Fußballerinnen über Gebühr privilegiert. Für den zweiten Platz in Wembley erhielten sie 30.000 Euro pro Nase (von drastisch erhöhten Werbeeinnahmen ganz abgesehen). Selbst für deutsche Olympiasieger beiderlei Geschlechts gab es lediglich 20.000. In Neuseeland und Australien zahlte man bereits 28.000 allein fürs Antreten, und die Siegerinnen bekamen jeweils 252.000. Insgesamt schüttete die FIFA an die 32 teilnehmenden Verbände Prämien in Höhe von rund 103 Millionen aus. Zum Vergleich: Für den grandios herausgespielten zweiten WM-Platz erhielt der Deutsche Eishockey-Verband gerade mal 700.000 Euro Preisgeld. Auch Magdeburg, immerhin Champions-League- Sieger im Handball, hatte sich mit einer Million für den Verein zu begnügen. „Unterprivilegiert“, um diese zeittypisch paradoxe Bezeichnung zu verwenden, sind somit eher 99 Prozent aller betriebenen Sportarten, die nicht (mehr) im Rampenlicht des ganz großen Interesses stehen oder bewusst vernachlässigt werden: Tischtennis, Rudern, Turnen, rhythmische Sportgymnastik, Ringen, Judo, Schwimmen, Reiten, Basketball, Badminton etc.
Vielfach gefährdet das mediale Desinteresse zugunsten der politisch Bevorzugten die Existenz von Vereinen. Doch die Vertreter aller Mainstream-Parteien schwärmen aus, um eine „Gerechtigkeits“-Lücke zu schließen. Wie sagte schon der bedeutende französische Dramatiker Jean Giraudoux: „Man erkennt den Irrtum daran, dass alle Welt ihn teilt.“
Sprechen wir noch über die deutsche Nationalmannschaft, die Sie als „Flaggschiff des deutschen Fußballs“ bezeichnen. Was stimmt mit ihr nicht?
Zunächst ein paar Sätze darüber, was eine Nationalmannschaft ist, die diesen Namen verdient, und was sie speziell einmal für Deutschland war. Wer immer über Tradition spricht, landet beim 1954er „Wunder von Bern“. Obwohl inzwischen nur noch wenige Deutsche aus unmittelbarem Erlebnis davon zehren, hat es den Wert eines quasi mythischen Sieges bewahrt. Und die ihn erstritten, gelten als beispielhafte Helden, allen voran Fritz Walter, Toni Turek oder Helmut Rahn. Das 3:2 gegen Ungarn zeigt den Gefühlsgipfel dessen, was Sportler ihrer Nation schenken können. Ein Gemeinschaftserlebnis, das damals für alle Zeiten zu definieren schien, was es bedeutet, das schwarz-weiße Trikot mit dem Adler zu tragen. Die fleißigen, bescheidenen, disziplinierten, mit einem Schuss Genialität gemixten Fußballarbeiter von Bern hatten schließlich neun Jahre nach Kriegsende ein zerrissenes Land im Fußballfieber fast wieder geeint. Nach Schätzungen hörten 60 Millionen Radiohörer zu und feierten eine Art sportliche Selbstbefreiung. Auch die Niederlagenserie nach der WM hatte keine Abkehr von den Sporthelden zu Folge. Denn Sympathie für sportliche Repräsentanten eines Landes ist nicht nur an Siege geknüpft. Die momentane Ergebniskrise unserer Nationalkicker halte ich daher für das kleinste Problem der aktuellen Misere (Das Interview wurde im Februar 2024 geführt, Anm. d. Red.). Niederlagen gefährden das Gefühlsband zwischen Team und wirklichen Anhängern nämlich nur dann, wenn diese den Eindruck haben, dass die Protagonisten nicht alles taten, das böse Schicksal abzuwenden. Thermopylen- oder Nibelungenkämpfer hingegen entbindet der Mythos vom schlichten Resultat. Eher bezieht man die Protagonisten in die kollektive Trauer mit ein. In diesem Sinne erhielten etwa deutsche Mannschaften, die 1958 gegen Schweden, 1966 gegen England oder 1970 in Mexiko gegen Italien den Kürzeren zogen, auch ihren großen Bahnhof. Dasselbe galt für Kroatien, dem trotz staunenswerter Leistungen (Zweiter und Dritter, Anm. d. Red.) WM-Titel letztlich versagt blieben. Schließlich zeigte dieses Land mit kaum mehr Einwohnern als Madrid, dessen Team mit den Fans zu einer großen Familie verschmolz, welche Krä!e eine tiefere nationale Verpfichtung freisetzt. Island hat sogar nur ein Zehntel der Bevölkerung und warf doch einst England aus dem EM-Turnier. Selbst die Färöer ärgern immer mal wieder vermeintliche Favoriten. Argentiniens WM-Team war eine einzige Verkörperung nationaler Solidarität. Und zuletzt konnte man selbst in Freundschaftsspielen die Mannschaften der Türkei und Österreichs (stimuliert durch traditionelle Nachbarschaftsrivalität) als verschworene Einheit erleben, wogegen die Deutschen ohne echten Zusammenhalt wirkten. Ihre Truppe vermittelte eher den Eindruck, als hielten einzelne ihre ständig wechselnden Frisuren oder die ihnen aufgepfropften Agenden für wichtiger als das zu vertretende Land.

Ob Nahostkonflikt oder Anschläge in Europa: Die Gefahr des Islamismus kehrt auch zu uns zurück. Über die Entwicklungen und die Strategien der Islamisten lesen Sie in der neuen FREILICH-Ausgabe „Heiliger Hass“.
Jetzt bestellen: www.freilich-magazin.com/shop
Wie viel Nostalgie schwingt in solchem Urteil mit? Aktuell dominiert doch eher der fußballerische Globetrotter mit einem oft lockeren Verhältnis zu seinem Geburts- oder Einwanderungsland.
Stimmt. Internationale Sportsöldner geben heute den Ton an. Die „Helden von Bern“ erhielten für ihren Triumph der Fama nach gerade mal eine Armbanduhr. Aber den meisten von ihnen traute man ohnehin zu, dass sie Hunderte von Kilometern zu Fuß zum Bundes-Sepp gepilgert wären, nur um für Deutschland zu spielen. Schon die folgende Generation wusste nicht mehr so recht, welche Vorbildfunktion ihnen zukam: die Beckenbauers, Netzers, Breitners und Co., coole Vertreter ihrer Branche, die bei der Heim-WM im Prämienpoker zu streiken drohten. Der damalige Bundestrainer Schön, Gentleman alter Schule, wollte darauf sein Amt niederlegen und ließ sich nur schweren Herzens umstimmen. Dass dies keine nachhaltigen Sympathieverluste mit sich brachte, lag vornehmlich daran, dass diese Generation Siege in Serie einfuhr.
Was heute die meisten DFB-Funktionäre mentalitätsmäßig von den Vor-1970ern trennt, liegt auf der Hand. Sie denken wie ihre Spieler in Vermarktungs- und PR-Kategorien. Der Emotionswert des Begriffs „Deutsche Nationalmannschaft“ wird von ihnen kaum höher taxiert, als es Produktmanager bei der Vorstellung neuer Marken empfinden. Ihnen kam nicht in den Sinn, dass eine Hymne vor Spielbeginn mehr bedeuten könnte als Queens „We are the champions“, weshalb sie es ins Belieben der einzelnen stellten, ob jemand singen wollte. Natürlich finden sich hierzulande antipatriotische Neurotiker zu hunderten, die sie darin noch bestärken. Der DFB allerdings sollte der Letzte sein, dies zu billigen, sondern als Leitsatz schon für seine Juniorenspieler festlegen, dass rausfliegt, wer sich der Hymne standhaft verweigert. Sie ist schließlich der stellvertretende Schwur einer intakten Mannschaft, alles für die sie anfeuernde Gemeinde zu tun, die sie international vertritt. Wer Deutschlands Symbolen nichts abgewinnen kann, möge ihr fernbleiben. Ins Herz kann und soll man niemandem schauen, aber von Repräsentanten eines Landes darf man zumindest ein paar Lippenbewegungen erwarten.
Wenn der DFB dies nicht fordert und sich stattdessen lediglich exzessiv auf Diskriminierungssuche begibt, trägt er die Hauptschuld an der Misere. Desgleichen, wenn er seine immigrierten Spieler nicht auf Konflikte vorbereitet, die in multikulturellen Verhältnissen in gewissem Rahmen erwartbar sind. Dazu gehört auch eine gewisse Resistenz gegenüber Internetpöbeleien, wenn Fans ihren Frust über grottenschlechte Spiele abreagieren. Solidarität und Schutz vor solchen Angriffen sind selbstverständlich. Aber ständige Larmoyanz bei diesem Thema verbittert selbst eine nicht von Phobien getragene Zuschauermehrheit. Die erhofft nämlich von den Eingebürgerten sogar, wie vergeblich in der Regel auch immer, mal ein gutes Wort über das Gastgeberland, nicht nur Kritik über wirkliche oder vermeintliche sozialintegrative Defizite. Erst das vermittelt über rein athletische Verstärkung hinaus das Gefühl einer wirklichen Bereicherung durch Zuwanderung
Aber sind denn nicht Nationalmannschaften in von Massenimmigration geprägten westlichen Gesellschaften meist nur mehr Anachronismen, die durch Geschäftsinteressen am Leben gehalten werden?
Im Prinzip schon. Der Entschluss vieler Spieler, für Deutschland aufzulaufen, ist daher nicht unbedingt eine Herzensentscheidung. Und es mehren sich Fälle, in denen fremdstämmige Nachwuchsfußballer, die bereits in DFB-Juniorenteams ausgebildet bzw. eingesetzt wurden, später für andere Länder antreten. Faktisch läuft die Wahlmöglichkeit auf die Frage hinaus, ob sich der Umworbene eine Karriere eher zu Hause oder bei anderen Verbänden zutraut. Und nun beginnt ein unwürdiges, immer früher einsetzendes Wettbieten um die umschmeichelten Jungstars, während die Entscheidung, für ihr Geburtsland aufzulaufen und damit ein Bekenntnis erfolgreicher Eingliederung abzulegen, häufig die geringste Rolle spielt. Das ist so, aber ist damit nicht gut, und man sollte dagegen angehen, indem man Werbung fürs DFB-Team mit Gelassenheit verbindet: Reisende soll man nicht aufhalten. Kein Spieler ist so wichtig, dass man ihn unbedingt haben muss, wenn dies den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft nicht stärkt. Man kann den öffentlichen Wert auch ideeller Güter nur steigern, wenn man sie verknappt.
Haben Sie Verständnis dafür, dass sich inzwischen immer mehr frühere Fans freuen, wenn die Nationalmannschaft verliert?
Ehrlich gesagt bin ich in meiner Haltung ihr gegenüber inzwischen selbst schon gespalten. Natürlich freut mich, wenn auch bei uns große Spieler heranreifen und unser Land im internationalen Wettbewerb würdig vertreten. Auch hofft man ja stets, dass ein positiv verlaufendes massengetragenes Fußballfest als gemeinschaftsstärkendes Erlebnis gefeiert werden kann und im günstigsten Fall entsprechende Impulse auch über ethnische Differenzen hinweg aussendet. Aber dann steht mir wieder ein DFB vor Augen, der jeglichen Erfolg mit freiheitsfeindlichen sportfremden ideologischen Zielen verkleistern wird, wie es sich niemand wünscht, dem dieses Land wirklich am Herzen liegt. Ich muss im Jubel über geschossene Tore verdrängen, welche verleumderischen Diffamierungen der einzig nennenswerten Opposition dieser politisch unterwanderte Fußballverband jetzt schon mitträgt. Allen voran die jüngste widerliche Anti-AfD-Kampagne, die per Konstrukt einer „Geheimkonferenz“ zur „Massendeportation“ sämtliche Kriterien einer Verschwörungstheorie erfüllt. Zudem ahne ich schon jetzt, welche peinliche Medienhysterie ausbricht, sollte sich auch nur in jedem fünften EM-Spiel irgendein Depp im Stadion nicht so verhalten, wie es unsere Sittenwarte billigen. Und was die grüne Staatsministerin Claudia Roth und der ehrgeizig-beflissene Turnierdirektor Philipp Lahm als sogenanntes kulturelles Begleitprogramm bereits angekündigt haben – 300 Veranstaltungen mit deutlicher Schlagseite gegen „rechts“ und für Wokistan –, verleidet mir das pure Vergnügen an fußballerischen Höchstleistungen. Da müssen die Jungs mit dem Adler wirklich schon berauschend spielen, wenn sie manche Bitterkeit über die schamlose Instrumentalisierung des Sports zu Wahlkampfzwecken wenigstens kurzfristig vergessen lassen sollen.
Aber könnte eine erfolgreiche EM vielleicht eine ähnliche patriotische Begeisterung auslösen wie die WM 2006?
Glaube ich nicht. Es sei denn, Nagelsmanns Truppe holte den EM-Sieg. Erfolg verschönt bekanntlich alles, und er gliche nach langem Herumtappen in fußballerischer Wüste dem Einzug ins sportliche Kanaan. Was das in seiner Folgewirkung überschätzte „Sommermärchen“ 2006 betrifft, bestand es nicht zuletzt in einem (von Merkel geschickt genutzten) Propagandacoup, zu dem das Gros unserer politischen Klasse seinen Segen gab. Fans durften erstmals, weithin unbekrittelt, normal sein und flächendeckend Deutschlandfähnchen schwenken, zusätzlich befeuert vom Bitburger Biermanagement. Auch in diesem Jahr ist von Regierungs- und Wirtschaftsseite vieles vorbereitet, um das Turnier für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Aber gerade ihr penetrantes politisches Framing zur Ausgrenzung der Wahlkonkurrenz verstört etliche, die Patriotismus nicht mit „Partyotismus“ verwechseln.
Und zum Abschluss bitte ich noch um Ihren EM-Tipp: Wer wird Europameister?
Fragen Sie lieber die Glaskugel! Natürlich favorisiere ich bestimmte Mannschaften, darunter die im europäischen Ranking ohnehin hochgehandelten. Ein Außenseiter, der gut startet, bleibt immer gefährlich, und meist beflügelt der Heimvorteil. Ob es für Großes reicht? … Wenn das gut organisierte Österreich sich in der „Todesgruppe“ vorn behauptet, kann es weit kommen. Doch Titel vorherzusagen, habe ich mir schon lange abgewöhnt. Zu viele Unwägbarkeiten sind im Spiel: Verletzungen, Schiedsrichterentscheidungen, überdurchschnittliches Pech, die Form ausgelaugter Spieler nach einer langen Saison. Fußball ist letztlich – vergessen wir es bei aller Software-Gläubigkeit nicht! – auch Glücksspiel. Nur selten gewinnt die „beste“ Mannschaft das Turnier. Ein schwaches Spiel, zwei Minuten oder Sekunden Unaufmerksamkeit, und alles kann vorbei sein.
Genug der Plattitüden fürs Phrasenschwein! Als Titelprophet tauge ich nur mäßig, was mir schon als Jugendlicher hätte klar sein können. Mit meiner Mutter bildete ich monatelang eine Tippgemeinschaft. Ich kannte damals den ungefähren Tabellenstand sämtlicher deutscher Teams der höchsten Ligen wie ihre Spitzenspieler. Selbst ihre Formkurven hätte ich nachbeten können, aber gewonnen habe ich nie. Als meine Mutter ohne jeden blassen Schimmer vom Fußball durch beliebiges Ankreuzen als erste einen Toto-Gewinn einstrich, stieg ich frustriert aus dem Wetttheater aus.
Vielen Dank für das Gespräch!
Zur Person:
Der Germanist und Historiker Prof. Dr. Günter Scholdt wurde 1946 in Mecklenburg geboren. Er lehrte an der Universität Saarbrücken und leitete bis zu seinem Ruhestand 2011 das „Literaturarchiv Saar-Lor-Lux-Elsass“. Seine Forschungs- und Publikationsschwerpunkte betreffen neben der Literatur des Dritten Reichs und der Inneren Emigration aktuelle gesellschaftliche und politische Deformationen.
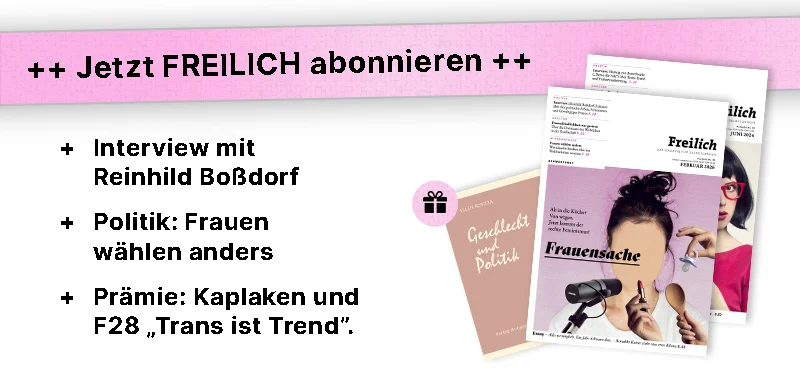




Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!