Das Technische Museum Wien erweitert den Ausstellungsbereich „Mobilität“ um das Thema Raumfahrt.
Wien. – Telefon, Navigation, Fernsehen, Logistik, Umweltmanagement, Wetter- und Klimabeobachtung: Die Raumfahrt ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die Dauerausstellung „Mobilität“ im Technischen Museum Wien widmet sich deshalb ab 6. April verstärkt dem Thema Raumfahrt.
Gemeinsam mit dem ersten Österreicher im All, Franz Viehböck, namhaften Vertretern der Weltraumszene und innovativen Organisationen aus dem Bereich Weltraumforschung und -technologie wurde der neue Ausstellungsbereich im Zuge einer Diskussionsveranstaltung Dienstag feierlich eröffnet. „Wie aktiv und erfolgreich österreichische Player in Weltraumforschung und -technologie involviert sind, ist vielen nicht bewusst. Mit der Ausstellungserweiterung wollen wir innovativen Projekten eine Plattform bieten und zeigen, wie weitreichend die Auswirkungen dieses Zukunftsthemas sind“, erklärt Generaldirektor Peter Aufreiter die Zielsetzung des neuen Ausstellungsbereichs.
Einzigartige österreichische Raumfahrtgeschichte
Der neue Bereich im Technischen Museum Wien widmet sich vor allem dem Beitrag Österreichs zur Weltraumforschung und -technologie. Die AustroMIR-Mission im Jahr 1991, in der der Wissenschaftskosmonaut Franz Viehböck als erster und einziger Österreicher im Weltraum eine Woche lang 17 Experimente durchführte, wirkte dabei fast wie eine Initialzündung. Der neue Bereich zeigt nicht nur originale Objekte der Mission, wie etwa den Raumanzug von Franz Viehböck, sondern auch die medizinischen und technischen Experimente, die wichtige und nachhaltige Impulse lieferten: So wird die Messung der Strahlungsbelastung für RaumfahrerInnen auf der ISS noch heute mit Dosimetern durchgeführt, die für AustroMIR entwickelt wurden. Mit den AustroMIR-Experimenten MIGMAS-A und LOGION konnte wertvolles technisches Know-how zum Verhalten von Ionenstrahlen in der Schwerelosigkeit gewonnen werden, das in die Entwicklung von Ionentriebwerken „Made in Austria“ einfloss. Daneben entstand eine heimische Zulieferindustrie für den Satelliten- und Raketenbau, die auch von Aufträgen der Europäischen Weltraumorganisation ESA profitiert. Seit den 2000er-Jahren wurden Satelliten und Raketenstarts immer günstiger. In der jetzigen Phase der Raumfahrt, auch „New Space“ genannt, bauen immer mehr Staaten, private Firmen und sogar Universitäten und Schulen ihre eigenen Satelliten und betreiben Weltraumforschung.

Österreich im „New Space“
Auch österreichische Firmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen mischen im „New Space“ mit. Vom Satellitennavigationsempfänger über Isolationsfolien, Ionentriebwerke, Treibstofftanks bis zum speziellem Weltraumcomputerchip: In jeder europäischen Rakete und in vielen Satelliten weltweit befindet sich Weltraumtechnologie aus Österreich. „Wir freuen uns sehr, dass das Technische Museum Wien nun als eine Art ‚Schaufenster‘ für die österreichischen Weltraumaktivitäten agiert. So erlebt ein breites Publikum nicht nur die inspirierende heimische Innovationskraft, sondern auch die gesellschaftspolitische Bedeutung der Weltraumforschung und der satellitenbasierten Daten für Klima und Umwelt, Mobilität sowie Sicherheit“, ergänzt Margit Mischkulnig, Abteilungsleiterin für Weltraumangelegenheiten im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.

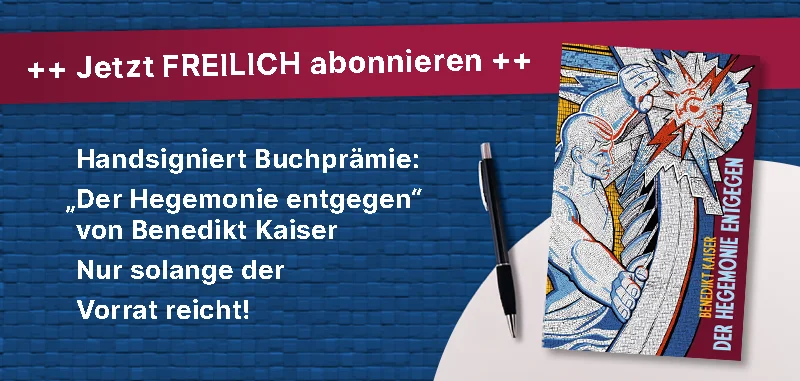
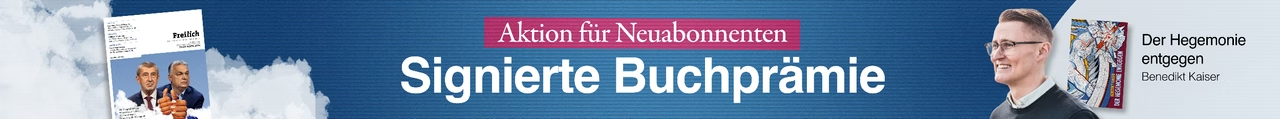

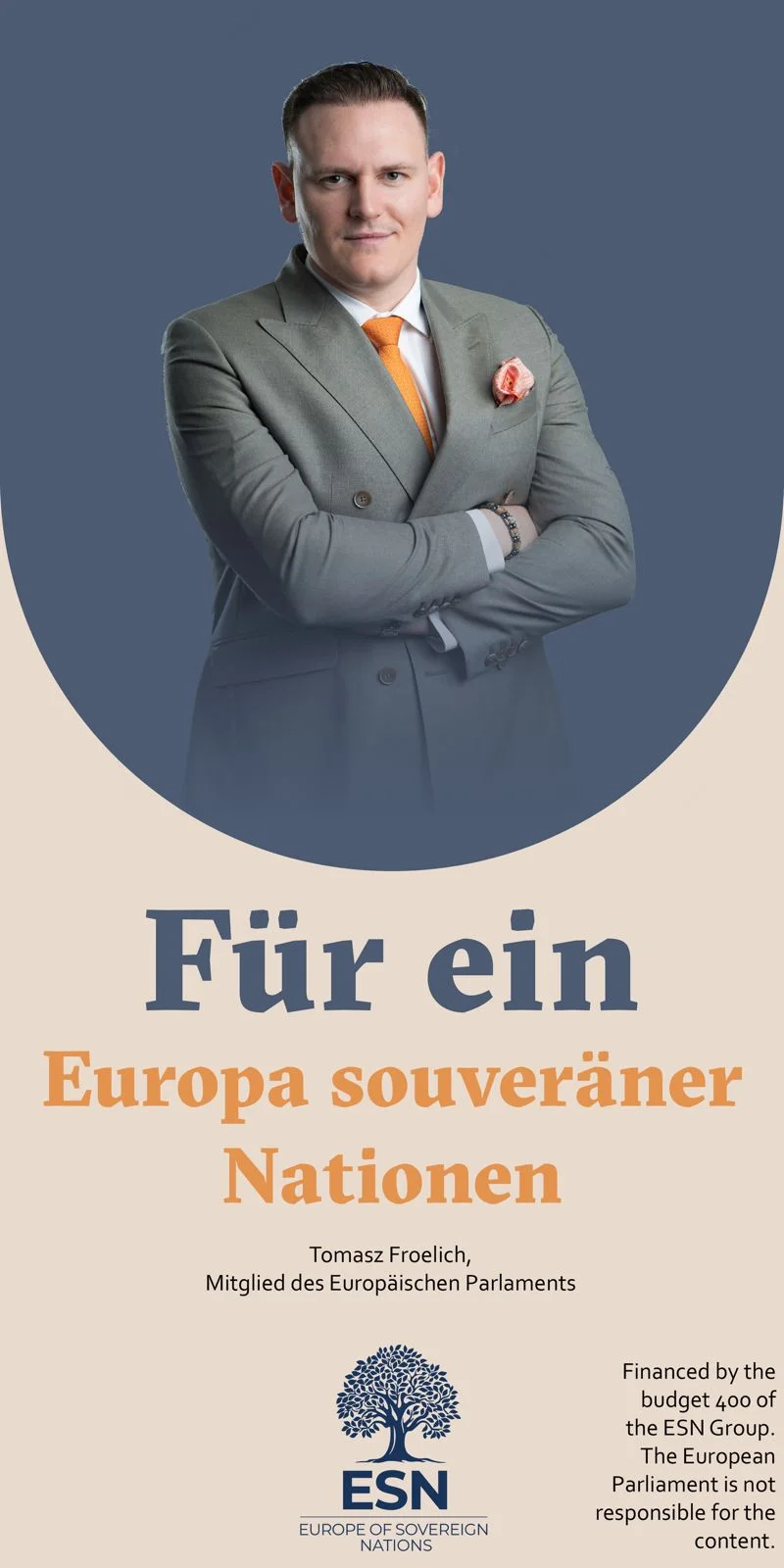

Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!