Ellen Kositza, Literaturredakteurin der Zeitschrift Sezession, spricht im TAGESSTIMME-Interview über jugendliche Eskapaden, ihre Erfahrungen in der Dark-Wave- und Techno-Szene und warum es heute keine vitalen Subkulturen mehr gibt.
TAGESSTIMME: Frau Kositza, wie fanden Sie als junge Frau zur Musik?
Ellen Kositza: Ich erinnere mich noch gut an den Sommer, bevor ich dreizehn wurde. Ich spielte damals besonders häufig, dass ich ein Pferd sei und Hindernisbahnen meistern musste. Ich baute mir komplizierte Parcours auf. Zugleich war mir klar, dass das mit der Kindheit nun leider ein Ende haben musste. Ich grübelte viel über die Rolle, die ich demnächst einnehmen wollte. Ungern wollte ich werden wie meine Mutter oder meine vielen älteren Cousinen. Also mit dreizehn Kaffeetrinken beginnen, mit vierzehn Dauerwelle, mit fünfzehn Rezepte ausprobieren. Ich besuchte eine Mädchenschule und mir graute vor der dort üblichen Teenagerrolle als Tussi. Ich hörte damals The Cure und Depeche Mode und hatte mir einen Ordner angelegt, in dem ich mithilfe meines kiloschweren Dictionaries sämtliche Texte übersetzte.
Mein Vater war ein großer Musikhörer und Konzertgänger, er hatte mich als Kind auf The Queen und Blondie geprägt, beides mag ich bis heute. Freddie Mercurys Stimme ist krass elektrisierend, dito Debbie Harrys Auftreten. Er hört bis heute gern auch Härteres. Als er mich zum ersten Mal auf Konzerte mitnahm, war ich 13: Judas Priest und Accept. Da war ich bereits kein Pferd mehr.
TAGESSTIMME: Sie waren als Jugendliche meines Wissens nach in mehreren Subkulturen unterwegs: Technoszene, später dann Dark-Wave. Wie haben Sie diese Szenen damals erlebt und was hat Sie angezogen?
Kositza: Ich war nie teil einer „Clique“ oder einer Szene. Meinen Musikgeschmack teilte ich aber mit meiner Freundin Frauke. Wir hatten gehört, dass es in Offenbach eine Samstagabend-Disco gebe, die für „junge Leute“ war und nur bis halb elf ging. Das war auch für unsere Eltern ok, die mit dem Auto vor dem Veranstaltungsort warteten. Wir, damals 13, wurden Stammkunden.
Rasch wurde klar, dass die interessanteren Leute dort nur „vorglühten“ und dass es hinterher weiterging. Vom Hörensagen konnten wir demnach eine Landkarte der Frankfurter Locations entwerfen und erahnen, was uns reizen könnte und was nicht. Das Funkadelic – voll mit GIs – und das Cookys – der populäre Club für langhaarige Studenten – eher nicht, auch nicht die vielen Discos im Umland. Auf lange Sicht waren wir überall mal, aber die Favoriten waren letztlich der „Technoclub“ unter Sven Väths Ägide im Omen und die Frankfurter Flughafendisco Dorian Gray. Drittens die Gothicbude Negativ in Sachsenhausen, viertens die Batschkapp in Frankfurt-Eschersheim. Zwischen meinem 15. und 19. Lebensjahr war ich wöchentlich mindestens dreimal unterwegs. Eher mehr.
Legendär waren die Freitagnächte, die vor allem im Dorian Gray stattfanden. Ausweiskontrollen gab es damals nicht. Ich sah eher aus wie 24 als 14, und mein höchster Ehrgeiz war, cool zu wirken. Und dann rein ins Getümmel. Meine Eltern gingen davon aus, dass ich bei Frauke übernachte. Was ich nie tat. Aber samstags um acht Uhr früh war ich immer pünktlich in der Schule. Übernachtet bzw. die rare Zeit zwischen vielleicht vier und sieben Uhr früh geruht wurde immer bei Zufallsbekanntschaften.
Heute würde ich die Wände hochgehen, wenn sich eine meiner Töchter so was rausnehmen würde. Ich war stets per Anhalter unterwegs – eine S-Bahn von Offenbach nach Frankfurt gab´s damals noch nicht – und nächtigte bei sicher oft sinistren Typen. Über all die Jahre hatte es aber nie einen „Me too“-Vorfall oder irgendwelche heiklen Situationen gegeben. Ich bilde mir ein, dass ich wohl so eine Ausstrahlung hatte, dass man sich mir nicht ungefragt nähern sollte – aber vielleicht hatte ich auch nur unwahrscheinlich viel Glück gehabt bei meinen riskanten Eskapaden.

Ja, Drogen wurden oft gereicht. Da ich schon mit Haschisch ungute Erfahrungen hatte und mich ohnehin gut drogenfrei in Rauschzustände versetzen konnte, verzichtete ich gern. Erwähnenswert mag auch sein, dass das Rhein-Main-Gebiet damals zwar ähnlich multikulturell war wie heute. Die Veranstaltungen, die ich besuchte, waren aber durchweg biodeutsch.
Im Dorian-Gray-„Technoclub“ war es so, dass man zunächst eine „Chill-Out-Lounge“ betrat. Von der Einlasstheke hatte man sich das Fanzine Frontpage mitgenommen, worin über die neuesten Veröffentlichungen und Veranstaltungen berichtet wurde. Darin blätterte ich – zurechtgemacht mit Minikleid, Doc Martens, dick kajalumrandeten Augen und viel Haarspray-, während auf einer Kinoleinwand „Die Fliege“ oder „Necromantic“ flimmerte. Richtig los ging es gegen Mitternacht. Es gab einen kleinen Saal für Gothic / Dark Wave und einen großen für Techno. Ich wechselte dauernd. Im Gothicraum tanzten die verzweifelten Träumer und Melancholiker, im Technobezirk die Hünen in Hemden und kurzen Hosen. Es war beides magnetisch.
„Die Fliege“ ist in der Tat ein wunderbarer Film. Sich verändernde Körper, „Neues Fleisch“ etc. Das waren ja alles Dinge, die Sie offenbar irgendwie in der Techno-Ästhetik verkörpert sahen. War das Ihr persönlicher „Film“, oder gab es unter den Tanzenden so etwas wie eine Philosophie?
Kositza: Mein „persönlicher Film“ ist seit 1999 „Die Frau auf der Brücke“ beziehungsweise „La fille de sur pont“. Diesen Streifen liebe ich wirklich über alles. Ich kann kaum sagen, wie oft ich ihn gesehen habe und wie sehr ich ihn mag! Aber das war ja schon post-juvenil. Damals in den späten Achtzigern als „Teenie“ hatte ich überhaupt keinen – akademischen – Begriff von Ästhetik, Kunst und Philosophie. Ich sog das damals nur gefühlsmäßig auf. „Die Fliege“, sicher ein dutzendmal gesehen, war nur so ein einstimmendes Bad damals für mich. Man bekam dadurch „so ein Gefühl“, das man – also: ich – gar nicht intellektuell ausdifferenzieren wollte.
Wie groß waren die Überschneidungen der Techno- mit der Dark-Wave-Szene damals? Gab es da jeweils einen „typischen“ Menschenschlag?
Kositza: Meiner Erinnerung nach gab es wenig Überschneidungen. Ich empfand mich jedenfalls als einzige Wanderin zwischen diesen Welten. Ich mochte sowohl das nachdenkliche Kauern und Rumtaumeln der „Waver“ als auch das faschistische Gestampfe, die hochgereckten Hände und die geraden, großen und muskulösen Körper in der Techno-Zone. Und dazu das riefenstahlartige Lichterspiel! Pure Endorphinausschüttung! Teil einer Masse sein, einer jungen, straffen, mobilen! Wohl zum Glück habe ich allerdings nie einer Loveparade beigewohnt. Ich habe die Techno-Szene nie als „shiny happy people“ empfunden, sondern als streng und auf eine Art militaristisch.
Eine gewisse Überschneidung zum Dark Wave gab es im Bezirk EBM/Industrial. Es war einfach elektrisierend. Nitzer Ebb, „Murderous“, es bleibt phantastisch! „Youth! It´s time to know! It´s time to live! Lift up your hearts!“ Für mich war es damals pure Magie. Und ich nahm solche Impulse sehr ernst. Entflammt sein hieß für mich nicht: für ein paar ekstatische Minuten, sondern ich nahm es als, naja, lebensphilosophischen Appell. Was mich vermutlich vom großen Rest unterschied. Wo wäre ich heute sonst?
Inwieweit haben Sie auch die Inhalte der Dark-Wave-Musik fasziniert oder beeinflusst? Stichwort: Mittelalter, Esoterik, Antimoderne …
Kositza: Wie gesagt hatte ich beizeiten mein The Cure– und Depeche Mode– Kompendium. Den Liedtext zu „Stripped“ mag ich bis heute, und ich muss allein aufgrund des Geräuschs stets – also täglich – an das Lied denken, wenn ich unseren Diesel-VW-Bus anwerfe. In meinem Jugendzimmer hing ein Din-A-Null-Plakat von Robert Smith, wie er so verlassen mit seiner Gitarre dasteht.
Mit schwarzem Edding hatte ich die bekannten Nietzschezeilen hinzugekritzelt: „Wohin ist Gott? Wir haben ihn getötet – ihr und ich! Wir alle sind seine Mörder! Aber wir haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir das ganze Meer auszutrinken? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts?“
Das war eigentlich die Blaupause, die ich in allen möglichen Variationen in Texten wiederfand. Oft hört man ja nur einzelne Ausrufe und Textzeilen, die einen befeuern. Oft, haha, was sich nachher herausstellt, verhört man sich auch und interpretiert Dinge hinein, die vom Lieddichter gar nicht gemeint waren …
Ich hatte lange Zeit einen Zwist damit, dass ich „rechts“ war, aber dennoch schwer von der Vergnügungskultur lassen konnte. Ich war für ein paar Jahre echt hedonistisch. Mit ungefähr 19 Jahren begann mir die Party- und Clubszene langweilig zu werden.
Ich sehnte mich sehr nach einem Kind und bekam dann ja auch rasch das erste. Bis zum dritten Kind war ich dank Mithilfe meiner Eltern noch öfters unterwegs. Dann gar nicht mehr. Es fehlte mir auch nicht. Doch – auf dem WGT war ich auch später noch paarmal.
Das Stichwort „Neofolk“ hatte ich erst spät gehört, es kam Jahre nach dem Mauerfall durch den Kontakt „gen Osten“ mit Stephan Pockrandt auf mich. Pockrandt gab die subkulturellen Magazine Sigill, Zwielicht und Zinnober heraus, für die ich auch zur Feder griff. Kapellen wie Forseti und Orplid, deren Köpfe ich für Genies halte, waren eine späte Offenbarung für mich. Aber mit Mitte, Ende zwanzig fühlte ich mich zu alt für eine Jugendkultur. Ich meide seit langem entsprechende Konzerte. Diese Atmosphäre „wir so um die fünfundvierzig und dennoch am Feiern“ geht mir total auf den Senkel.
Widersprechen sich Hedonie und Rechtssein denn so sehr? Das Hedonistische ist ja auch schon ein bisschen das Dionysische und Ekstatische, ergo ja auch irgendwie „rechts“. Und hat sich das in der Wave-Szene nicht auch irgendwie widergespiegelt? Und auch im Techno-Bereich gab es doch damals Sorgen um eine etwaige „Unterwanderung“.
Kositza: Ja, das ist ein guter Einwand! Nicht, was die Sorgen um „Unterwanderung“ betrifft. Ich mein: Alle nicht klassisch linken Projekte haben und hatten stets Angst vor Unterwanderung. Mir gefällt das – gut so! Wo hygienisch vorgegangen wird und man stets um Abgrenzung gegen etwaige „rechte Einflüsse“ bemüht ist, ist es schon mal keine Subkultur. Vermutlich gibt es auch deshalb heute keine Subkulturen mehr …
Aber wegen meiner ausgeprägten Ausgeh- und Tanzlust hatte ich schon ein irgendwie schlechtes Gewissen. Für „weiblich, rechts, dionysisch“ gab und gibt es ja keine Repräsentanten, an die frau anknüpfen könnte! Auf der rechten Seite ist die Verknüpfung von Weiblichkeit mit Mutterschaft fast unhintergehbar. Das finde ich letztlich auch logisch und folgerichtig. Der Gedanke an ein voriges „Austoben“ ist sicher eher neu.
Die rechte Sphäre, in der ich mich schreibend bewegte, war sehr konservativ. Das wurde mir auch vermittelt. In Leserbriefen – Junge Freiheit – wurde mein „Gossenton“ beklagt, und aus dem Herzen der Redaktion kamen auch arge Bedenken wegen meiner Umtriebigkeit.
Mit siebzehn und achtzehn Jahren – mir ist es wichtig: b e v o r Tattoos Mode wurden! – hatte ich mir einige „vitalistische“ Bildchen stechen lassen. Unter anderem Efeuranken in Erinnerung an Nietzsches dionysisch-rasende Mänaden, und eine Lebensrune.
Damals nahm ich mir noch sehr zu Herzen, wenn andere mich kritisierten. Das war ein Dilemma, was ich erst spät überwunden habe: Ich wollte sichtbar „anders“ sein, litt aber unter Kritik. Längst hab ich mir das abgewöhnt. Das war eine echte Erlösung.
Welche Bands und Alben haben Sie damals beeinflusst?
Kositza: Beeinflusst, so hoch würde ich es gar nicht hängen. Ich hab mich von Stimmungen befeuern lassen und nicht von bestimmten Stichwortgebern oder Künstlern.. Nach der Depeche Mode– und Cure-Phase, also so ab 15, hörte ich „privat“ kaum Musik, mal abgesehen von „Darklands“ von The Jesus and Mary Chain, da kenne ich heute noch alle Lyrics auswendig.
Neben Clubs besuchte ich wahnsinnig viele Konzerte, meist in der Batschkapp: Laibach – sicher viermal-, Death in June, Front 242, Deine Lakaien, aber auch ganz andere Musikrichtungen.
Ich war sogar bei Madonna im Waldstadion – und zwar auf der VIP-Tribüne, weil ich einen Wettbewerb gewonnen hatte… Als Kontrastprogramm war ich auch immer mal auf Skinhead-Konzerten – auch eine Erfahrung wert, die ich nicht missen will.
Witzigerweise war aber das allerbeste Konzert, das ich je besucht habe, ausgerechnet von den Ärzten, im Volksbildungsheim in Frankfurt. Es muss etwa 1990 gewesen sein, und es war Ausgelassenheit und Tanzfreude pur. Ich mochte und mag es, wenn es vital ist und pulsiert!

Sie waren ja über längere Zeit im Umfeld der Dark-Wave Band Forthcoming Fire aktiv, sind auch auf einer Aufnahme der Gruppe zu hören. Wie kam dieser Kontakt damals zustande?
Kositza: Genau weiß ich das gar nicht mehr. So mit 19 war ich ja Beiträgerin des Ullsteinbuches „Wir 89er“, herausgegeben von Roland Bubik. Bubik war damals genialer Redakteur der letzten Seite der Jungen Freiheit; die Rubrik hieß „Zeitgeist und Lebensart“. Dort hatte ich als Schülerin meine ersten Artikel geschrieben. Im besagten Buch dann hatte ich unter anderem einen Disco-Abend im Frankfurter Maxims geschildert: Wie die Trottel dort aufgepeitscht zu „F*** you, I won´t do what you tell me“ von Rage against the Machine ihre Dreadlocks aka Drecklocks schütteln und in Wahrheit doch nur angepasste Nichtsnutze sind.
Jedenfalls gab es irgendwann einen „Jungautorenwettbewerb“ von der JF. Und als ersten Preis wurde „Ein Abend mit Ellen Kositza im Maxim´s“ ausgelobt. Ich fiel schier vom Hocker, als ich das las. Das war nämlich keinesfalls mit mir abgesprochen. So nötig hatte ich es nun nicht.
Dazu kam noch ein großer Artikel im FOCUS zum Thema „Die neuen Wilden“, wo ich neben einer hübschen Männerskulptur des „umstrittenen“ Bildhauers Georg Kolbe, die damals noch in Offenbach stand, abgelichtet wurde. Später im Text hieß es dann: „Diskotheken-Walküre Ellen Kositza fragt sich, ob es noch richtige Männer gibt.“ Rund um diese Zeit bekam ich sehr viel Post von Leuten, die mich kennenlernen wollten. Unter anderem übrigens von einem gewissen mir bis dahin unbekannten Götz Kubitschek, der mich damals nach meinem Lieblingsbuch fragte.
Damals kam es auch zum Kontakt mit Josef Maria Klumb, den ich auf gewisse Weise schnell als eine Art „Seelenverwandten“ empfand. Das Stück auf dem Album damals ist mir heute aber eher peinlich. Ich mochte seine andere Band Weissglut viel lieber. Damals waren Weissglut ja von einem sehr großen Plattenlabel unter Vertrag genommen worden. Die CD-Release-Party in Frankfurt war eine absolute Wucht. Josef sprang dort während seines Auftritts von Tisch zu Tisch, was für ein Temperament, welch ein Furor! Wenig später wurde er ja als „Rechtsextremist“ denunziert, und die große Karriere war futsch. Interessanterweise kam ich nach meiner paarjährigen „neopaganen“ Phase unter anderem durch Klumb zum Christentum zurück. Der legendäre, grausam ums Leben gebrachte Pfarrer Hans Milch war ja sein Mentor gewesen. Viel später ließ ich meine Kinder in der ehemaligen Gemeinde von Pater Milch zur Erstkommunion gehen. Auch Götz und ich heirateten dort.
Nachdem Forthcoming Fire ihr Interview in der Jungen Freiheit gegeben hatten (1996?), kam es zu einem saftigen Medienrummel um die Band. Wie haben Sie das damals wahrgenommen? Waren Sie auch an der späteren Umwandlung – wenn man es so nennen will – von Forthcoming Fire in Von Thronstahl beteiligt?
Kositza: Nein, schon nach Josefs Umzug von Bingen nach München wurde der Kontakt sporadisch. Witzig übrigens: Mein altes Forthcoming Fire-T-Shirt habe ich einer Tochter vermacht. Sie boxt mittlerweile ganz beachtlich im Verein und bringt erste Medaillen nach Hause. Das FF-Shirt ist ihr Trainingshemd, daher denke ich oft bei der Wäsche an alte Zeiten.
Möchten Sie unseren Lesern zum Abschluss noch einige Musiktipps ans Herz legen?
Kositza: Die Sammlung der Beethoven-Symphonien der Wiener Philharmoniker, dirigiert von Christian Thielemann.
Zur Person:
Ellen Kositza, geboren 1973 in Offenbach/Main, studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie und ist Mutter von sieben Kindern. Sie war seit 1992 als freie Autorin für die Junge Freiheit tätig, ist seit 2008 Redakteurin der Zeitschrift Sezession und gehört zu den Gründern des Netz-Tagebuchs Sezession im Netz. Ebenfalls 2008 erhielt sie den Gerhard-Löwenthal-Preis für Publizisten.
Twitter: https://twitter.com/EKositza
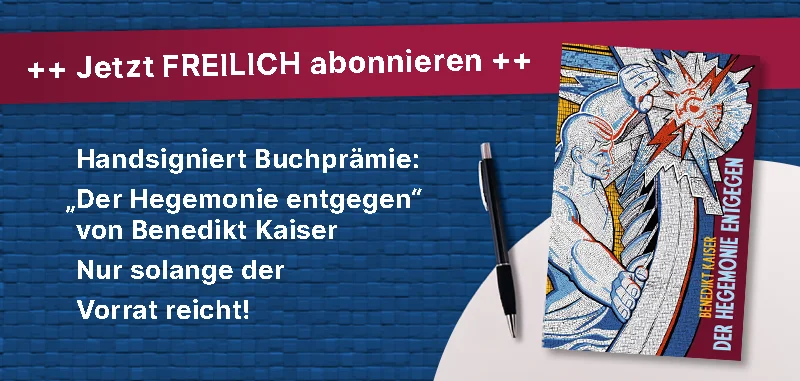




Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!