FREILICH: Lieber Herr Mohr, Ihre Novellen sind geprägt durch Gegensätze, die Protagonisten etwa in Die Staubdämonen werden beispielsweise durch den kühlen Realisten und die sensible Träumerin verkörpert. Es bahnt sich Unheilvolles an, überall ätzender weißer Staub, Gebäude stürzen ein. Lässt Sie die geistige Situation unserer Zeit diese Geschichten schreiben oder woher kommt die Inspiration für die Szenen, die immer zwischen Wirklichkeit und dystopischen Träumen changiert?
Volker Mohr: In Die Staubdämonen ist es ein Virus, das den Zement zersetzt und zu Staub werden lässt. Das Buch wurde kurz vor Corona geschrieben; es nahm die Ereignisse auf anderer Ebene voraus. Die Vorwegnahme der realen Ereignisse ist, wie ich festgestellt habe, symptomatisch für mein Schreiben. Das gelingt jedoch nur, wenn man nicht einem Konzept, sondern eben der Inspiration folgt – wenn man offen dafür ist, was einem „zufällt“. Die traumartigen Sequenzen deuten dabei auf das Unbewusste hin, aus dem das einem Zufallende letztlich kommt.
Gleichzeitig öffnet das Traumhafte neue Räume. Es erweitert die Handlungs- und Denkebenen und lässt Dinge zur Sprache kommen, die dem Autor und somit auch dem Leser sonst verborgen geblieben wären. Das Zauberhafte, das im Traumhaften mitschwingt, wird dann real, während das Reale zugleich zauberhaft wird.
Befassen Sie sich mit Politik bzw. beeinflusst diese Ihr Schreiben?
Politik, obwohl ich ein distanziertes Verhältnis dazu habe, beeinflusst mich emotional und somit fließen politische Ereignisse zumindest indirekt in mein Schreiben ein. Ich nehme die aktuellen Strömungen vor allem durch Erlebnisse, Gespräche und „unabhängige“ Medien wahr. In den neusten Novellen Unter Menschen und Der verlorene Himmel bin ich aufgrund der speziellen aktuellen Ereignisse näher am Politischen. Grundsätzlich halte ich es jedoch mit Ernst Jünger: Interessant ist die Großwetterlage und weniger die täglichen Hochs und Tiefs.
(...)
Die Lektüre der Geschichte regt gedanklich dazu an, anzunehmen, dass jegliche Gebilde, die keinen inneren Zusammenhalt besitzen, irgendwann auseinanderbrechen würden. Leben wir in Gesellschaften und auf einer materiellen Substanz, denen dieser innere Zusammenhalt fehlt? Was hält diese Gesellschaft überhaupt noch zusammen?
Beim Beton, der in Die Staubdämonen eine wesentliche Rolle spielt, ist der Zement das Verbindende. Zement stellt jedoch eine künstliche Verbindung her; er verbindet Dinge, die von sich aus nicht zusammengekommen wären. In der modernen Gesellschaft ist es analog dazu das Soziale. Dadurch entstehen künstliche Gemeinschaften oder Kollektive, während gewachsene Verbindungen zunehmend ausgeschlossen werden. In Kollektiven ist niemand mehr für irgendetwas verantwortlich, niemand fühlt sich mehr an etwas gebunden. Das führt dazu, dass der Einzelne darin zunehmend isoliert ist.
In Die Staubdämonen werden die Verlautbarungen der Medien als Impfungen beschrieben, die wiederholt über „Auge und Ohr“ dem Massenmenschen in Wiederholungen verabreicht werden müssen, damit er weiterhin daran glaubt. Gibt es für den Einzelnen andere Optionen oder einen anderen Ausweg, als an die verordneten Wirklichkeiten zu glauben?
Natürlich gibt es das. Jeder Mensch besitzt ein Empfinden, die Möglichkeit, Welt in sich zu finden. Das bedingt jedoch, dass er seine Lebenseinstellung aus sich selbst und nicht aus der Vorgabe der Masse – auch nicht einer abweichenden Masse – bezieht. Dass er nicht dem Beifall und der Bestätigung folgt, sondern den eigenen Bildern, dem eigenen Urteilsvermögen vertraut. Damit soll keinesfalls dem uneingeschränkten Individualismus das Wort geredet werden, sondern vielmehr dem, was man bei uns einst unter Demut verstanden hat.
Sie beschreiben in Ihrem Essay Der Verlust des Ortes die Symptomatik der modernen Gesellschaften bezogen auf den Ort als identitätsstiftende Heimat. Der Jetztmensch lebe vor allem als Verbraucher und pseudoindividualistischer Massenmensch, er baue und wohne nicht mehr, er sei entortet und wurzellos. Ist der Jahrhunderte währende Fortschrittsglaube das ursprüngliche Übel oder doch ein sanft aufkeimender Totalitarismus wie in Eschenhaus von Jörg Bernig?
Seit sich der Massenwohnungsbau zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts etabliert hat, ist die Wohnung zu einem Aufenthaltsort geworden. Zwar wurde durch die allgemeine Technisierung der Komfort gesteigert, aber die Normierung der Bauteile und der Bauten hat zu einer ästhetischen Verarmung geführt und zur Vereinzelung des Menschen beigetragen. Die Architekten haben sich dieser Geisteshaltung unterworfen. Heute wird mancherorts bereits verlangt, dass mit einer Baueingabe gleichzeitig ein Entsorgungskonzept eingereicht wird. Die Verpackung muss nach dem schnellen Konsum der Ware entsorgt werden.
Der sanft aufkeimende Totalitarismus – der im Grunde gar nicht so sanft ist – ist vor allem eine Folge des Fortschrittsglaubens. Fortschritt in dem Sinn wie er heute verstanden wird, gleicht einem Scheck, der nicht gedeckt ist. Indem man fortschreitet – fort vom Eigentlichen, Wesentlichen – verliert man letztlich jede Bindung an ein übergeordnetes Moment. Dazu kommt, dass Fortschritt mit Entwicklung verwechselt wird. Entwicklung führt zur Erfahrung und zur Eigenständigkeit, Fortschritt zur Isolation.
Weiter im Essay ist von Fensterflächen im modernen Bauen die Rede, die aufgrund ihrer Größe wie aufgerissene Augen einen Einblick ins Innere des Privatbereichs bieten und spielen an auf das Phänomen, dass ein Teil des heutigen modernen Selbstverständnisses die ungenierte Zurschaustellung des eigenen Ichs ist. Was steckt hinter der Ideologie der Selbstvermarktung des Ichs?
Das ist schwer zu sagen. Auffallend ist jedoch, dass die Selbstvermarktung, die ja bereits wesentlicher Bestandteil von Ausbildungsgängen ist, in dem Maß zunimmt, in dem die Identität und die Inhalte des Einzelnen abnehmen. Das egoistische „Selbst“ wird hervorgehoben – Selbstmitleid, Selbstkontrolle, Selbstsicherheit, Selbstmord etc. –, weil man zum Eigenen keinen Zugang mehr hat.
Wie sähe ein Bauen und Wohnen aus, dass den Ort zur Heimat macht und Identität stiftet? Woran müsste es sich orientieren?
Zu orientieren hätte es sich an den ewig gültigen Werten. An Strukturen und Hierarchien, die in den Dingen begründet liegen. Heimat, und damit auch der heimatstiftende Ort, entstehen aus einer entsprechenden Geisteshaltung heraus.
Es ist symptomatisch, dass „Heimat“ ein auf das deutsche Sprachgebiet beschränktes Wort ist. Der Deutsch-Sprechende kann, wie vielleicht kein anderer, Heimat empfinden. Das Potenzial, das darin begründet liegt, ist nicht zu unterschätzen. Es stellt gleichsam ein Fundament dar, auf dem sich Großes errichten lässt. Großes im kulturellen, denkerischen und wissenschaftlichen Bereich. Um das zu unterbinden, mussten die deutschen Städte, die der Inbegriff für Heimat und Identität waren, zerstört werden – zunächst durch den Krieg, danach in noch größerem Umfang, durch Ressentiments gegenüber dem Eigenen und Anbiederung an den Fortschritt. Wohin das geführt hat, sehen wir seit langem: zu unwirtlichen, charakterlosen, überfremdeten Zentren und Agglomerationen – zu ödem Gebiet.
Weil „Heimat“ aber in der deutschen Sprache gründet, kann man – solange das Wort noch erlaubt ist – darauf zurückgreifen. Wer Heimat empfindet, kann Heimat auch zulassen, kann sie aus sich entstehen lassen.
Die Familie im eigentlichen Sinne wird in der Gegenwartsgesellschaft mehr als Übel denn als Gut betrachtet. Mütter werden zur Not durch Quoten in Positionen gebracht, Väter sollen alles Mögliche sein, aber bitte keine Männer. Sehen Sie durch die Schwäche der natürlichen Vorbilder eine Ursache für die Krise des Ortes?
Das geht vermutlich Hand in Hand. So oder so geht es heute aber darum, das Gewachsene, Gegebene und letztlich das individuelle Schicksal zu negieren. An deren Stelle hat das künstlich Geschaffene zu treten, das, im Gegensatz zum Gewachsenen, gerecht sein soll. Gemachte Gerechtigkeit bedeutet aber, dass letztlich alles gleich sein muss. Beim Ort sehen wir das schon lange: Jede Agglomeration sieht aus wie die andere. Das heißt: Wenn die Orte gleich sind, sind es auch die Menschen, die darin wohnen. Oder eben umgekehrt: Wenn die Menschen sich einander angleichen, tun dies auch die Orte.
(...)
Wer durch seine Stadt läuft, bemerkt den Kontrast zwischen der Architektur des zeitgenössischen Bauens und der denkmalpflegerisch verwalteten Substanz. Als schön wird allerdings nur letzteres wahrgenommen. Sind wir nicht mehr in der Lage, schöne Originale zu erschaffen?
Solange das Bauen, von der Planung bis zur Ausführung, ein industrialisierter Prozess ist, können keine Originale entstehen. Es kann Kühnes, Spektakuläres, Außergewöhnliches und Zweckdienliches entstehen, aber echte Strukturen, die ursprünglich sind und somit eine Seele und Charakter haben, sind dadurch kaum möglich.
Wie sieht Ihrer Meinung nach ein Stadtraum aus, der die Identifikation des Menschen mit seiner Stadt wieder möglich macht?
Die Identifikation mit der Stadt setzt die Identifikation mit sich selbst oder generell mit dem Leben voraus. Eine Stadt, die auf menschlichen Massen gründet, von einem Geist getragen ist, ein Haupt, ein Herz und Glieder hat, ist etwas grundlegend anderes als ein maßloser, durchorganisierter Zellklumpen.
Es geht nicht primär darum, dass die Stadt und ihre Quartiere verdichtet und verkehrsfrei, dass die Häuser top isoliert, CO2-neutral und bezüglich der Raumeinteilung flexibel sind, sondern darum, dass das Leben seinen Ausdruck darin findet. Das vermag jedoch nur der lebendige, in sich freie Mensch.
(...)
Wäre es Ihrer Meinung nach möglich, durch die Nutzung moderner Bautechniken wie den 3D-Druck zu einem traditionellen und kunstvollen Bauen zu finden? Kann die „Perfektion der Technik“ identitätsstiftend sein?
Wohin die „Perfektion der Technik“ führt, hat Friedrich Georg Jünger in seinem gleichnamigen Buch treffend beschrieben. Da das Perfekte letztlich das Durchrationalisierte, Automatisierte und vielleicht sogar Fehlerfreie ist, ein übergeordnetes Moment aber ausschließt, kann es keinesfalls identitätsstiftend sein.
Im Gegenteil: Die Vorherrschaft des Technischen hat das ursprüngliche Handwerk, das Originales zu erschaffen imstande war, verdrängt. Es hat das Bauen zu einem genormten Vorgang werden lassen und dazu beigetragen, dass alles überall gleich aussieht. Wir verlangen zwar in allen Bereichen Diversität, erreichen aber genau das Gegenstück. Das Regionaltypische schwindet, und anstelle der Vielfalt entsteht die unendliche Variation des Immer-Gleichen. Wenn man bedenkt, dass all die gotischen und barocken Kirchen, aber auch Bürgerhäuser und Schlösser, ohne statische Berechnungen entstanden sind, lässt sich ermessen, was durch eine Haltung, die auf ein Ganzes – nicht auf Ganzheitlichkeit – ausgerichtet ist, was durch Empirie, also durch Erfahrung, Kunstfertigkeit und schöpferisches Tun entstehen kann.
(...)
Vielen Dank für das Gespräch!
Das vollständige Interview mit Volker Mohr lesen Sie in der FREILICH-Ausgabe 24 „Europa geht in Rente“. Hier im FREILICH-Buchladen bestellen.
Zur Person:
Volker Mohr, geboren am 14. August 1962 in der Nähe von Schaffhausen. Aufgewachsen in Thayngen (Kanton Schaffhausen). Lebt in Schaffhausen.
Studium der Architektur. Selbständige Tätigkeit als Architekt und Gestalter. Erste literarische Versuche in den Neunzigerjahren. In der Folge erschienen Erzählungen, Novellen, Essays, wobei die Themen um das Verhältnis von individuellem und kollektivem Schicksal kreisen – um die Frage nach der Identität und der persönlichen Souveränität.
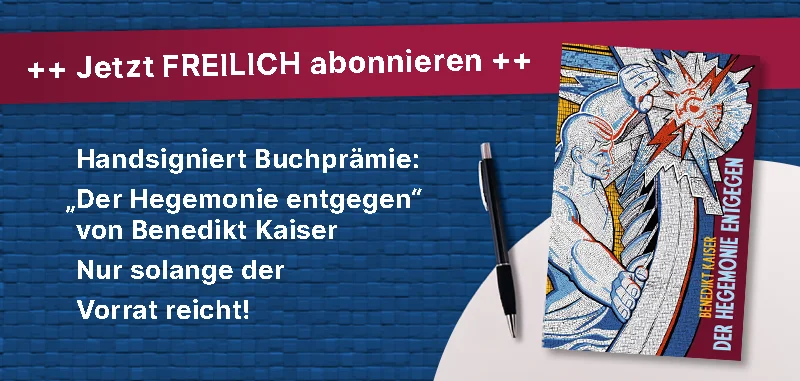





Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!