Die EU-Kommission kam zum Schluss, dass die österreichische Reform der Familienbeihilfe gegen geltendes EU-Recht verstoße. Aus diesem Grund entschied man sich, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich einzuleiten.
Brüssel. – Wie ORF.at berichtet, erklärte die zuständige Sozialkommissarin Marianne Thyssen aus Belgien diesen Schritt am Donnerstag der Öffentlichkeit. Man halte die Anpassung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder an die dortigen Lebensumstände für „zutiefst unsozial“ und schaffe Arbeiter und Kinder „zweiter Klasse“. Der Ansicht der EU-Kommission zufolge dämme der heimische Vorstoß keinen Sozialtourismus ein, sondern treffe insbesondere Menschen, welche einen Beitrag zum Sozialsystem leisten würden.
Beschwerde von acht Ländern wegen Kürzung
Dass Brüssel diese Reform nicht goutieren würde, kommt wenig überraschend. Bereits im Oktober – also noch vor der Verabschiedung des Gesetzes im Dezember – stellte man entsprechende Schritten in Aussicht. Offenbar wollte man allerdings noch das Ende der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr des Vorjahres abwarten. Seit Bekanntwerden der Pläne im Herbst beschwerten sie insgesamt acht EU-Länder bei Thyssen darüber. Die Indexierung gilt bereits seit Jahresbeginn.
Bürger all dieser Länder – Rumänien, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Polen, Bulgarien, Litauen und Slowenien – wären von einer Kürzung betroffen. Arbeiter aus Hochpreisländern, wie etwa Schweden, Belgien, Dänemark oder Luxemburg hätten hingegen sogar leicht profitiert. Im Jahr 2017 wanderten 253,2 Million Euro über die Kinderbeihilfe als Transferleistung ins Ausland. Die türkis-blaue Regierung erhoffte sich von der Indexierung jährliche Einsparungen von etwa 114 Mio. Euro. Von Kürzungen sind Eltern von insgesamt 125.000 Kindern betroffen.
Vertragsverletzungsverfahren als erster Schritt
Bei der Eröffnung des Verfahrens handelt es sich um den ersten Schritt, welche die EU-Kommission gegen das ihrer Ansicht nach nicht konforme Gesetz tätigen kann. Für Österreich bedeutet dieses Mahnschreiben allerdings noch kein Ungemach. Erst nach einer zweiten Mahnung mit Aufforderung zur Stellungnahme ist die Kommission berechtigt, den Fall vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH) verhandeln zu lassen.
Familienministerium bleibt gelassen
Mit entsprechender Gelassenheit fiel auch die Reaktion des zuständigen Sozialressorts von Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) aus. Sie verwies darauf, dass derartige Maßnahmen keinesfalls unüblich seien. Alleine im Jahr 2017 sei es beispielsweise zur Eröffnung von nicht weniger als 716 Verfahren gegen diverse EU-Mitgliedsstaaten gekommen. Auch derzeit seien noch insgesamt 1.500 aus verschiedenen Jahren offen.
Eine Überprüfung stehe der Kommission frei, man selbst gehe weiterhin davon aus, dass die vorliegende Lösung mit europäischen Recht vereinbar sei. Sollten die österreichischen Argumente die Kommission nicht überzeugen können, müsse der EuGH diese Entscheidung treffen, so Bogner-Strauß weiter. Man beruft sich in seiner Rechtsmeinung auf den renommierten Sozialrechtler Wolfgang Mazal, der in seinem Gutachten eine Vereinbarkeit mit EU-Recht bejahte.
Kleine Oppositionsparteien: „Verantwortungslos“
Die weitere Aufnahme der EU-Ankündigung in der heimischen Parteienlandschaft unterschied sich erwartungsgemäß zwischen Regierungsparteien und Opposition. Die Jetzt-Familiensprecherin Daniela Holzinger bezeichnete das „vorhersehbare“ Verfahren als Ergebnis einer „kurzsichtigen Kopf-durch-die Wand-Politik“ und warnte vor Strafzahlungen in Millionenhöhe. Das Vorgehen der Regierung sei deshalb „verantwortungslos“. Ähnlich argumentierte Michael Bernhard von den NEOS.
FP-Vilimsky: Kommission argumentiert „falsch“
Rückendeckung für die Sichtweise des Familienministeriums kam dafür vom freiheitlichen EU-Delegationsleiter Harald Vilimsky. In einer Aussendung erinnerte er daran, dass sich die Familienbeihilfe im Gegensatz zu ähnlichen Leistungen nicht an eine Erwerbstätigkeit kopple. Das neue Gesetz binde deren Empfang an den Wohnort des Kindes. Weil die Beiträge für den maßgeblichen Fonds außerdem ohnehin von Dienstgeberseite kämen, fiele die Argumentation des „Arbeiters zweiter Klasse […] wie ein Kartenhaus in sich zusammen“.
Er verwies auch auf das Ausmaß der Ungleichheit der Empfangsleistungen nach dem alten Modell. Er rechnete hierfür die viel geringere Leistung für ein Kind in manchen osteuropäischen Ländern anhand des rumänischen Beispiels vor. Hier lasse es sich „leicht ausmalen“, dass die österreichische Familienbeihilfe eher ein Zusatzeinkommen darstelle. Weil dies nicht „Sinn der Sache“ sein könne, sei die vorliegende Indexierung „mehr als gerecht“.
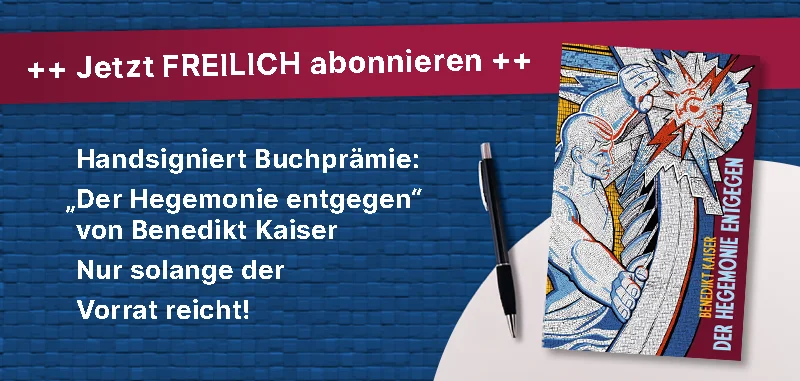


![Hält die Indexierung der Familienbeihilfe für „zutiefst unfair“: EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen. Bild (Thyssen 2017): Arno Mikkor / EU2017EE via Flickr [CC BY 2.0] (Bild zugeschnitten)](https://img.freilich-magazin.com/-/article/plain/s3%3A%2F%2Ffreilich%2F2019%2F01%2Fmarianne-thyssen-1200.jpg@webp)


Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!