Die „Moral“ des Bombenterrors lässt sich auf einen ganz einfachen Nenner bringen. Nach dem ergebnislosen Grabenkrieg des Ersten Weltkriegs mit seinen Millionen Gefallenen entwickelten die Pioniere der Luftwaffe ein Konzept des strategischen Bombenkriegs als Alternative: Wenn es gelang, die Schaltstellen der feindlichen Wirtschaft aus der Luft auszuschalten, konnte man sich derlei Blutopfer in Zukunft sparen. Kriege würde durch ein Duell über den Wolken in Kürze entschieden werden. Besonders attraktiv war diese Vision für Seemächte, die ungern größere Landarmeen aufstellten und ausrüsteten. Die Theorie war bestechend, bloß die Realität war eine andere – und wie so oft, hieß es: umso schlimmer für die Realität. Denn die Schaltstellen, die man angreifen wollte, waren mit den vorhandenen Mitteln einfach nicht präzise genug zu treffen (ein Problem, das sich später dann auch noch beim Einsatz der deutschen V1 und V2 stellte).
Von der Präzisionsstrategie zur Flächenbombardierung
Das Konzept der Luftpolizei bewährte sich in der Zwischenkriegszeit zwar in den Kolonien, vor allem in der Wüste, wo man sonst schwer hinkam. Doch im Krieg stellte man bald fest, dass die Ergebnisse des Bombenkriegs zu wünschen übrig ließen, noch mehr, wenn man gezwungen war, in der Nacht anzugreifen. Doch die Luftrüstung hatte inzwischen ihre Eigendynamik gewonnen. Nach zwei Jahren verlustreicher Operationen schaltete die britische Royal Air Force (RAF) im Februar 1942 daher auf Flächenbombardements um. Man griff Ballungszentren an, um wenigstens irgendetwas zu treffen – und irgendwo in Europa aktiv werden zu können. Oder anders ausgedrückt: Der Einsatz der vollen Gewalt moderner Kriegsmittel gegen zivile Subjekte war eine direkte Folge ihrer relativen Ohnmacht militärischen Objekten gegenüber. Nicht bloß die Industrie, auch der Arbeiter sei ein geeignetes Ziel, allerdings – wie selbst „Bomber-Harris“ zugab – nicht unbedingt ein lohnendes. Zwischen Wunschdenken und Rechtfertigung wurde zuweilen ins Treffen geführt, man hoffe so die „Moral“ in einem ganz anderen Sinn, nämlich den Kampfwillen des Gegners, entscheidend zu treffen – eine Spekulation, die sich in fast allen Fällen als irrig erwies.
Die Verselbstständigung des Bombenkriegs
Den Politikern wurde weiterhin versprochen, sobald man einmal über 4.000 viermotorige Bomber verfüge, werde man den Krieg im Alleingang gewinnen (auch wenn gerade Churchill da schon relativ früh Bedenken anmeldete). Doch als man diese 4.000 dann tatsächlich hatte (und Begleitjäger dazu), war der Krieg praktisch schon gewonnen. Lohnende Ziele waren kaum mehr vorhanden. Allenfalls Tieffliegerangriffe rentierten sich noch – aber dazu brauchte man keine schweren Bomber. Doch das konnte ein militärisch-industrieller Komplex, der fast die Hälfte aller Kriegsanstrengungen Großbritanniens aufgesogen hatte, schlecht zugeben. Also machte man weiter wie bisher – was Fritze unter dem Stichwort „Verselbständigungstheorie“ vermerkt. Die Alliierten nahmen damit zweifelsohne einen „unwirtschaftlichen Einsatz“ von Ressourcen in Kauf – wie Vertreter von Marine und Heer immer wieder monierten. Allenfalls konnte man so deutsche Ressourcen binden, wie zum Beispiel die berühmten 8,8 cm Geschütze, die sonst anderswo zum Einsatz hätten kommen können.
Völkerrecht und moralische Dilemmata im Luftkrieg
Fritze zeichnet diese Entwicklung im Einklang mit führenden Experten wie Horst Boog oder Richard Overy korrekt nach. Er erläutert zentrale Begriffe wie „Zivilisten“ und „militärische Objekte“ aus juristischer Perspektive. Als Völkerrechtler muss freilich auch er zugeben, dass es in der Regel keine bindenden Vorschriften über den Umgang mit neuartigen Waffensystemen gibt – wenn schon kein Vakuum, dann doch allenfalls Ableitungen aus dem Gewohnheitsrecht. Von dem Kardinalproblem einmal abgesehen, an wen man sich denn im Zweifelsfall zu wenden hätte, wenn derlei Regeln verletzt würden. Eine Kriegsdrohung hilft ganz offensichtlich nicht, wenn man sich ohnehin schon im Krieg befindet. Letztes Refugium ist allein der wechselseitige Nutzen: So hat zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg keine Seite Giftgas eingesetzt. Doch in „a-symmetrischen Kriegen“ greift diese Reziprozität nicht immer: Landarmeen verübten Repressalien gegen die Zivilbevölkerung, wann immer sich Nichtkombattanten zum „Widerstand“ verleiten ließen; Luftstreitkräfte nahmen Kollateralschäden größten Ausmaßes in Kauf, um zwischendurch vielleicht doch militärische Ziele zu treffen. Notabene, auch wenn bei Fritze nicht erwähnt: Der wohl größte „Kollateralschaden“ entstand, als 1938 rund eine Million Chinesen ertranken, nachdem ihre eigene Regierung die Dämme des Gelben Flusses durchstochen hatte, um die Japaner zu stoppen.
Doch als Philosoph will Fritze sich damit nicht zufrieden geben, sondern versteigt sich immer wieder in Argumentationen, bei denen er einräumt, sie mögen „rigoristisch“ oder „unrealistisch“ erscheinen – um sofort frohgemut fortzufahren: „was freilich für sich genommen moralphilosophisch noch nicht allzu viel bedeutet“. Im Seminar wohl nicht – doch sollte man dann besser nicht zu Nutzanwendungen zur „Gegenwartsorientierung“ ausholen. Fritze hat selbst ein Buch veröffentlicht, in dem er sich kritisch mit dem „moralischen Universalismus“ auseinandersetzt. Umso kurioser ist es, wenn er jetzt Churchill attackiert, weil der sehr plausibel argumentierte, dabei handle es sich um eine Frage der Mode. Wer immer sich die Kapriolen unserer „woken“ Zeitgenossen vergegenwärtigt, kann dem überzeugten Reaktionär Churchill da nur Recht geben. Der Rezensent ist vor Jahrzehnten mit Hans-Ulrich Wehler im „Historikerstreit“ aneinander geraten. Aber ich kann ihm nur vollinhaltlich zustimmen, wenn er von Fritze zitiert wird, man solle sich vor „moralisierenden Urteilen“ hüten.
Legitime Kriegsziele und historische Bewertungen
Im zweiten Teil seines Buches räsoniert Fritze über „legitime Kriegsziele“, die unglückselige Casablanca-Formel der „bedingungslosen Kapitulation“ und die Alternativen Englands im Frühsommer 1940. Über all das lässt sich trefflich streiten, doch auf diesem Gebiet ist Fritze mit der Literatur und den Interna weniger vertraut. Maßgebend waren in all diesen Fällen ganz andere Faktoren als sie Fritze mit seinen Exkursen zum „bellum iustum“ ins Visier nimmt. Diverse Herrschaften ziehen mit Vorliebe über die deutsche Wehrmacht her, die von den Zeitgenossen – auch auf alliierter Seite – noch bis in die siebziger Jahre sehr bewundert wurde. Doch traditionsbewusste Europäer sollten nicht in den Fehler verfallen, deshalb zur Abwechslung in derselben Manier auf die Ikonen des „Westens“ loszugehen. Fritzes Irritation über Sonntagsredner, die offenbar nicht umhin können, jedes beliebige Problem mit irreführenden Analogieschlüsse unter Rekurs auf Hitler abzuhandeln, ist durchaus nachvollziehbar. Doch es wäre ebenso irreführend, derlei propagandistische Manierismen tatsächlich als handlungsleitende Maximen zu begreifen. Gott sei Dank kommt es in der Weltpolitik auf das bundesdeutsche Feuilleton nicht an.
Schließlich, wenn schon Gegenwartsorientierung: Wer völkerrechtliche Postulate entwirft, sollte sich vielleicht genauso wie der binnenstaatliche Gesetzgeber auch Gedanken darüber machen, ob und wie sich diese Paragraphen in der Praxis umsetzen lassen, frei nach dem Motto: Tun Sie, was Sie nicht lassen können, aber lassen Sie, was Sie nicht tun können.
Lothar Fritze, Die Moral des Bombenterrors. Alliierte Flächenbombardements im Zweiten Weltkrieg (Dresden 2025) 522 Seiten, Jungeuropa Verlag, ISBN 978-3-948145-36-1. Hier bestellen: https://www.freilich-magazin.com/shop
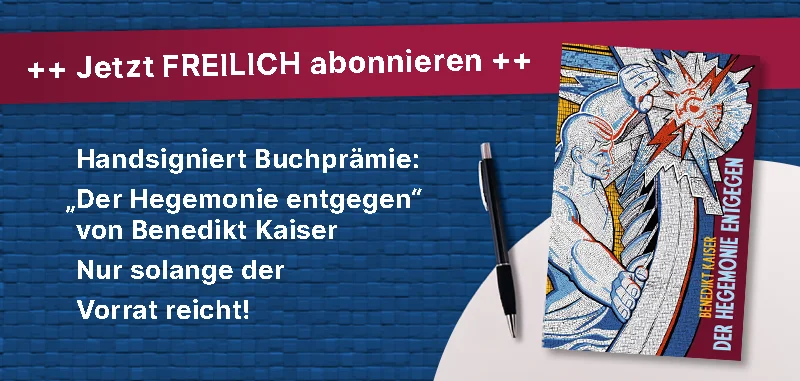
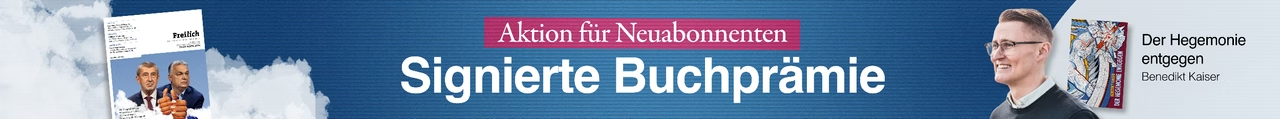

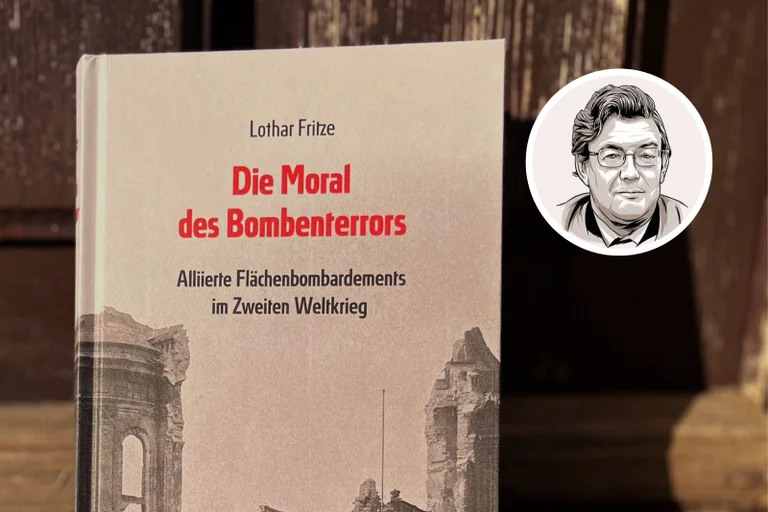
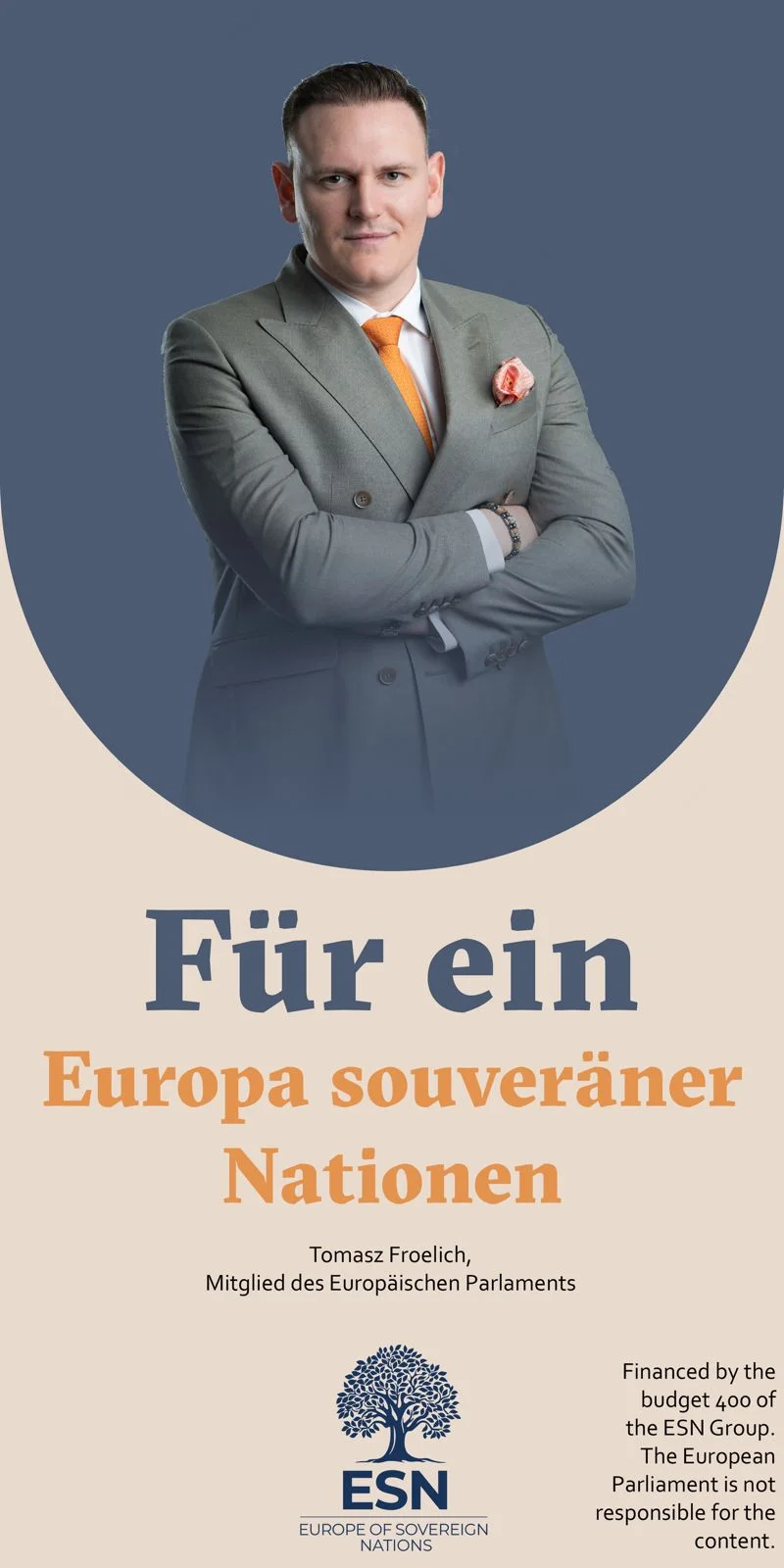

Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!