Wien. – In Österreich gebe es eine „starke Fetischisierung“ der Landessprache. Das sagt die Fluchtforscherin Judith Kohlenberger und meint damit, dass überzogene Ansprüche an Deutschkenntnisse Migranten vom Arbeitsmarkt fernhalten. Unternehmen und Politik würden, so ihr Vorwurf, an einer Realität festhalten, die längst nicht mehr zu halten ist.
Der Arbeitsmarkt im Sprachdilemma
Kohlenberger ist überzeugt, dass die österreichische Wirtschaft künftig nicht mehr ohne Zugewanderte auskommen wird – auch wenn diese zuerst einmal Geld kosten: „Manche müssen es sich leisten. Denn das ist zunehmend die Realität des vorhandenen Arbeitskräftepools.“ Spätestens nach der Rezession werde sich der Arbeitskräftemangel erneut verschärfen – besonders in der Industrie und in Niedriglohnbranchen.
Die Forscherin verweist darauf, dass die anfänglichen Kosten für die Einstellung von Zugewanderten zwar höher seien, dies jedoch von der Situation abhänge: „Wie gut ist das Sprachniveau? Und: Ist es der erste Geflüchtete, den ein Betrieb einstellt, oder arbeiten dort schon mehrere? Dann wird der Aufwand geringer.“
Von der Solidarität zur Pragmatik
2015 hätten sich viele Unternehmen mit öffentlicher Symbolpolitik solidarisch gezeigt. Heute sei davon wenig geblieben. „Wer jetzt Geflüchtete einstellt, macht das aus pragmatischen Gründen. Die sind aber ohnehin oft die besseren.“ Laut Kohlenberger ist die Hemmschwelle, Zugewanderte zu beschäftigen, in den vergangenen Jahren gesunken. In vielen Branchen sei ihre Präsenz längst selbstverständlich. „Inzwischen bedient uns in fast jeder Wiener Bäckerei ein Geflüchteter, das Gleiche gilt für die ÖBB.“
„Fürs Tellerwaschen muss keiner B2 können“
Kohlenberger kritisiert besonders scharf die Rolle, die Sprache auf dem österreichischen Arbeitsmarkt spielt. „Die Erfahrung zeigt, dass mangelnde Deutschkenntnisse der Hauptgrund sind, warum Geflüchtete nicht eingestellt werden.“ Zwar könnten Arbeitgeber theoretisch auf Sprachdefizite Rücksicht nehmen, in der Praxis seien sie jedoch ein Ausschlussgrund. „Gerade im niedrigqualifizierten Bereich wird es künftig immer weniger Muttersprachler geben. Daher wird man flexibler werden müssen.“
Kohlenberger verweist auf ein strukturelles Problem: „Im Vergleich mit anderen europäischen Staaten gibt es in Österreich, Deutschland und der Schweiz schon eine starke Fetischisierung der Landessprache.“ In den skandinavischen Ländern sei Englisch am Arbeitsplatz weit verbreiteter, wodurch Migranten, etwa aus der Ukraine, rascher Fuß fassten. Auch in Österreich gebe es Ausnahmen, wie der Tourismus zeige: „Die Mitarbeiter in Hotelküchen in den Tourismusregionen im Westen sind inzwischen international und die Gastronomen haben klar gemacht: Fürs Tellerwaschen muss keiner B2 können.“
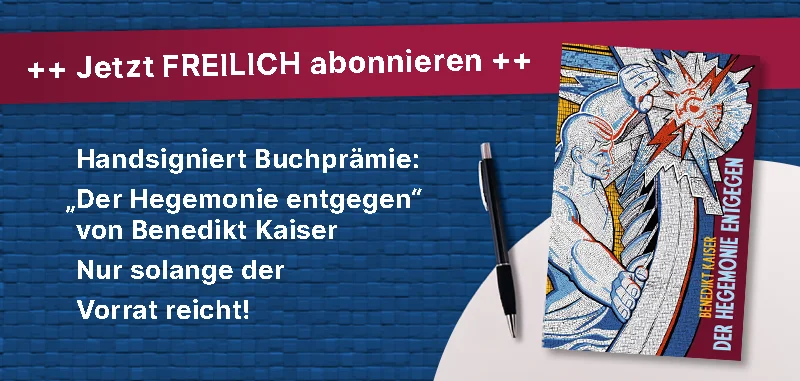
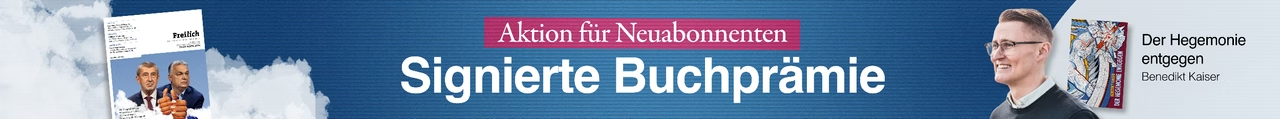

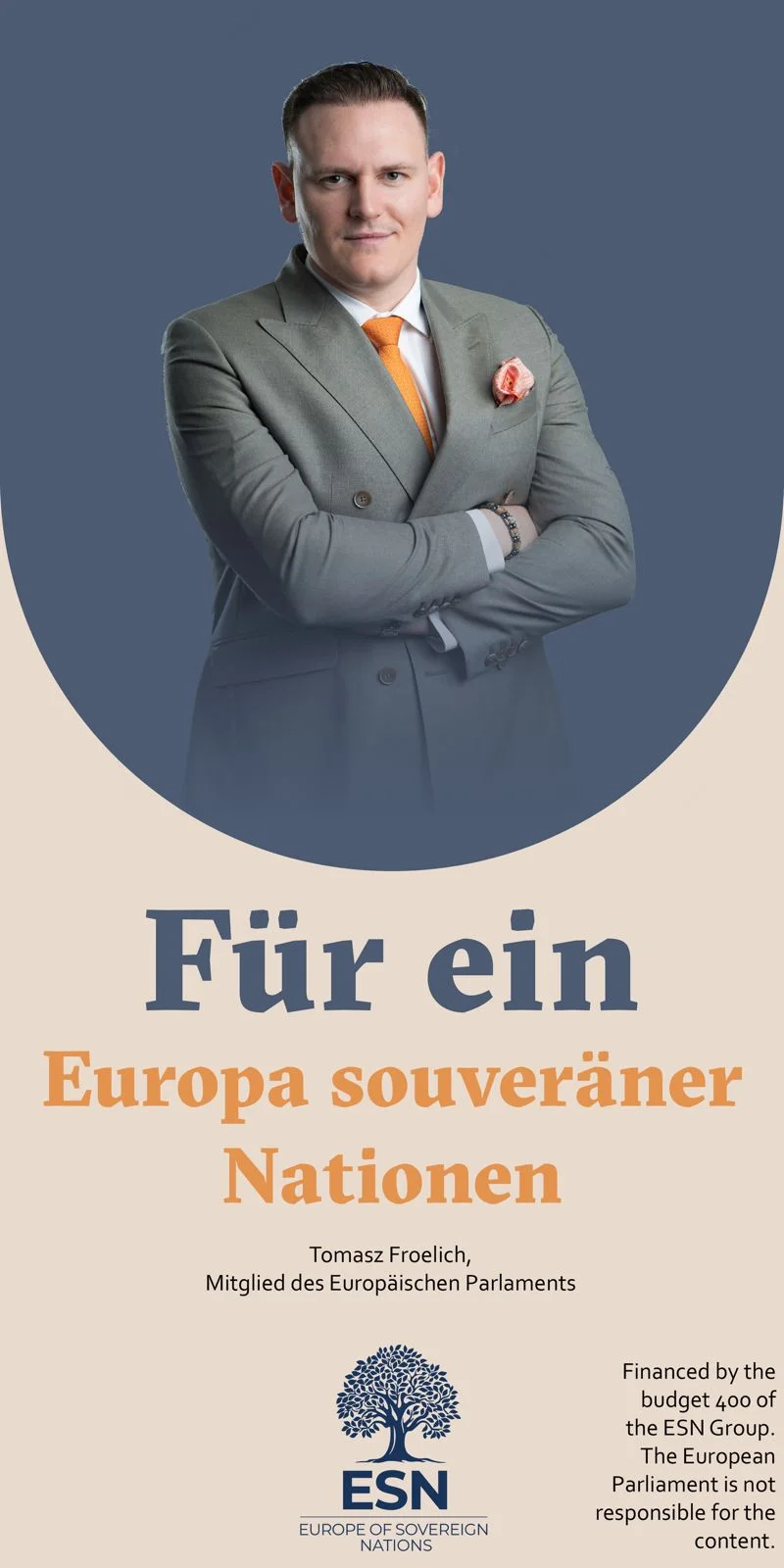

Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!