Zehn Jahre AfD: Das war Anlass zur Selbstvergewisserung, aber auch zur Selbstbefragung. Mein Beitrag zur Ambivalenz des Gründungsmythos der Partei, erschienen bei FREILICH-online, war ein solcher Versuch. Kein Abgesang, keine Revision, sondern ein Impuls, den bisherigen Weg mit klarem Blick zu reflektieren. Die Reaktion von Erik Lehnert in der Sezession würdigte diesen Impuls implizit, stellte ihn aber zugleich in ein fahles Licht. Seine Kritik entstellte meine Analyse, indem sie mir eine Unterstellung und Absicht unterschob, die es so nicht gab und die mir fernlag.
I. Der Ursprung: systemkritisch, nicht systemfeindlich
Die AfD wurde nicht gegründet, um eine bloß „andere Politik zu“ machen. Sie wollte Politik durchaus eben auch „anders machen“. Dieses „Anders“ war keine bloße Stilfrage, sondern eine grundsätzliche Infragestellung mit der etablierten Parteienpraxis: mit Klientelismus, mit Fraktionsdisziplin, mit der Rhetorik der Alternativlosigkeit. Es war eine Absatzbewegung gegen eine verkrustete politische Kultur, die mit Merkel den Bürger nicht mehr repräsentierte, sondern belehrte.
Lehnert sah darin einen Popanz: Die Gründung sei von CDU-Aussteigern getragen worden, die das System nicht ablehnten, sondern korrigieren wollten. Aber Biografien sind keine Programme. Wer das politische System von innen erlebt und sich dann zu einem Bruch entscheidet, tut dies nicht, weil er am Bestehenden festhalten will, sondern weil er es für reformunfähig hält, in dem damaligen Fall eben die CDU par excellence, aber eben nicht nur sie, sondern die gelebte Praxis der Parteiendemokratie.
II. Sloterdijk, „Totale Mitgliedschaft“ und die performative Kraft der AfD
Meine Bezugnahme auf Sloterdijks Begriff der „totalen Mitgliedschaft“ war kein rhetorisches Ornament, sondern ein analytischer Zugriff: Die AfD ist keine klassische Interessenpartei. Sie ist eine Formation, in der sich viele Menschen existenziell und als dissident verorten. Diese politische Tiefenbindung erklärt nicht nur ihre Resilienz, sondern auch ihr Polarisierungspotential.
Lehnert unterschätzte in seiner Kritik die performative Seite der AfD, ihren Anspruch, nicht nur andere Inhalte, sondern einen anderen Politikstil, ja, eine andere politische Ökologie zu schaffen, die im Anfang, in der Gründung, schon manifest war. Genau deshalb wurde sie schon von Beginn an eben nicht als neue Partei behandelt, sondern als Störfaktor. Nicht wegen ihrer Forderungen, sondern wegen ihres Auftretens, ihres Tons, ihres Ernstes.
III. Zuspitzung und Verhärtung: eine doppelte Dynamik
Hier lag der Kern meines Beitrags: Ich habe nicht behauptet, dass Björn Höcke oder der „Flügel“ die Ausgrenzung der AfD verursacht hätten, also er und Co. etwa an allem schuld wären. Die systematische Bekämpfung der Partei durch Medien, Altparteien und Regierungsschutzbehörden begann lange bevor sich die innerparteiliche Zuspitzung manifestierte.
Was ich allerdings analysiert hatte, ist die innere Reaktion auf diese Ausgrenzung: Das ursprünglich tatsächlich notwendige „Wir und die Anderen“ drohte in eine rigide Lageridentität umzuschlagen. Die AfD begann, sich selbst in einer Weise zu verfestigen, die die öffentliche Wahrnehmung bestätigte und verstärkte. Aus dissidenter Differenz wurde Konfrontation, aus interner und äußerer Konfrontation sich verfestigende Polarisierung. Diese Dynamik war nicht einseitig. Sie war dialektisch: Die totale Delegitimierung der AfD durch das Establishment erzeugte in Teilen einen innerparteilichen Habitus der Abschottung. Mein Plädoyer in „10 Jahre AfD“ war als Versuch gedacht, diese wechselseitige Verhärtung analytisch aufzulösen und einen strategischen Weg zurück in die Offenheit und Offensive zu zeigen.
IV. Keine politisch-inhaltliche (Zu-)Rücknahme, sondern Reifung und habituelle „Abrüstung“
Diese Öffnungsoffensive bedeutete nie und nirgends eine inhaltliche programmatische Rücknahme. Ich forder(t)e keine Anbiederung, keine semantische Anverwandlung an die Altparteien, vielmehr plädier(t)e ich für eine habituelle Neujustierung, ein Mehr an strategischer Selbstbeherrschung und diskursiver Souveränität.
Die AfD sollte sich des Spannungsverhältnisses zwischen den beiden Polen Grundsatztreue und Selbstverpanzerung bewusster werden und daraus strategische Konsequenzen ziehen. Sie darf ihr eigenes Anderssein nicht zum Dogma erstarren und gerinnen lassen. Wer regieren will, muss Mehrheiten, zusätzliches Vertrauen gewinnen, muss mehr sein als nur gedachte Gegenmacht. Er muss ein Bild davon geben, wie es besser geht – nicht nur in Paragrafen, sondern im Ton, in der Haltung, in der Ernsthaftigkeit.
V. Vertrauen gewinnen, ohne sich zu verbiegen
Vor allem im Westen ist die AfD – anders als im Osten – immer noch mit einer medial jahrelang zementierten Negativerwartung konfrontiert. Diese muss aufgebrochen werden. Nicht durch Rhetorik allein, sondern auch durch Habitus. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Bild, das andere von uns zeichnen, unsere Form bestimmt.
Deshalb: Vielleicht müssen wir in Richtung „agonale Demokratie“ den ersten Schritt tun, nicht aus Schwäche, sondern zwei Jahre später aus gewachsener strategischer Stärke. Nicht als Buhlen oder Bitte um Anerkennung, sondern als Angebot zur Erneuerung, nicht an die Funktionärseliten der offenbar unbelehrbaren Konkurrenz, sondern an den Wähler. Wer uns heute (noch) nicht wählt, muss morgen sehen können, dass wir bereit sind, für alle zu regieren – ohne uns selbst aufzugeben. Und die anderen machen es uns ja wahrlich leicht.
VI. Politikfähigkeit verlangt Formbewusstsein
Die AfD ist mehr als eine Oppositionspartei. Sie ist ein Projekt tiefgreifender Redemokratisierung als Repolitisierung. Dieses Projekt lebt nicht vom Trotz, sondern von der Gestaltungsfähigkeit. Lehnert hat natürlich recht, wenn er vor Anpassung warnt. Für eine solche habe ich aber auch nie plädiert und stünde auch nicht zur Verfügung! Aber wir müssen uns selbst davor warnen, im Ernst der Lage in der Pose der Abgrenzung zu erstarren. Von Berlin nach Schnellroda und zurück: Das ist keine geografische Wegstrecke, sondern eine Brücke hin und zurück.
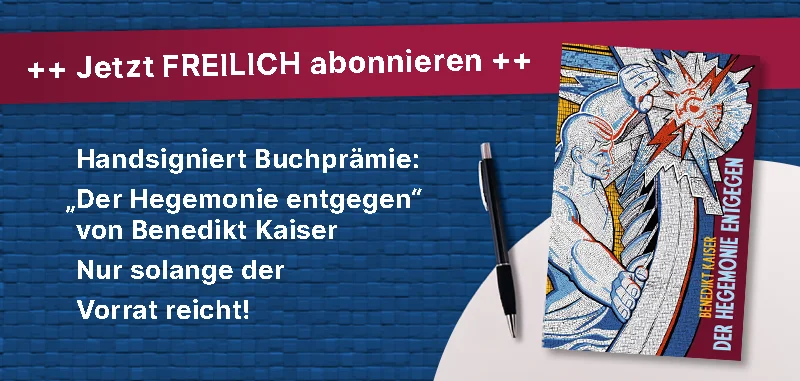




Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!