Bart De Wever ist seit gestern der erste flämisch-nationalistische Premierminister des Königreichs Belgien. Es ist paradox: Laut Statut seiner Partei, der „Neuen Flämischen Allianz“ (N-VA), strebt diese wörtlich „eine unabhängige Republik Flandern“ an. Also das Ende Belgiens. Wie soll das funktionieren?
De Wever steht heute an der Spitze einer belgischen Fünf-Parteien-Regierung aus flämischen Nationalisten, einer rechtsnationalistischen und eher wirtschaftsliberalen flämischen Partei, den flämischen Christdemokraten „Christendemocratisch & Vlaams“ und den flämischen Sozialdemokraten „Vooruit“, den Erben der belgischen Arbeiterpartei, und auf wallonischer Seite den Rechtsliberalen der größten wallonischen Partei „Mouvement Réformateur“ und einer ehemaligen katholischen Zentrumspartei „Les Engagés“. Das sind viele Parteien für eine Regierungskoalition, aber im belgischen Parlament, das 150 Sitze hat, gibt es sogar zwölf Parteien.
Möglich wurde dieser Erdrutschsieg durch einen radikalen Wechsel in der Wallonie, dem französischsprachigen Teil Belgiens. Dort hatten seit 1945 die eher sozialistisch orientierten Sozialdemokraten die Mehrheit. Bei den wallonischen Regionalwahlen im Juni 2024 erlitten sie und ihre traditionellen Verbündeten, die Grünen, eine beispiellose Niederlage. Zusammen verlieren sie 14 ihrer 33 Sitze und kommen nur noch auf 19 Sitze, während die bürgerlichen Parteien (Liberale und ehemalige Christdemokraten) plötzlich 15 Sitze hinzugewinnen und auf 34 Sitze kommen.
Wer ist dieser Mann?
Bart De Wever, geboren 1970, flämischer Historiker, Sohn eines Eisenbahners und einer Lebensmittelhändlerin, wurde 2004 Vorsitzender der N-VA. Damals war die N-VA eine Partei mit nur einem Sitz im Parlament. In den 20 Jahren seiner Präsidentschaft wurde sie zur größten Partei Belgiens.
Durch die „Normalisierung“ seiner Partei gilt die N-VA nicht mehr als rechtsextrem. Die Unabhängigkeit Flanderns als Ziel wurde in der Satzung beibehalten, aber pragmatisch zum „Konföderalismus“ weiterentwickelt: Belgien als „Doppelmonarchie“ Flandern-Wallonien nach dem Vorbild Österreich-Ungarns, der Tschechoslowakei, Jugoslawiens usw. Die Geschichte zeigt, was aus solchen Konstruktionen wird. Aber vielleicht ist genau das das geheime Ziel von Bart De Wever?
Jedenfalls hat diese Taktik auch ihre Nachteile: Der viel prinzipientreuere flämisch-nationale Rivale Vlaams Belang ist von drei Sitzen im Jahr 2014 auf 20 Sitze im Jahr 2024 aufgestiegen, sodass sich die Frage stellt: Wird Bart De Wever Belgien verändern oder wird Belgien Bart De Wever verändern?
Der Surrealismus ist in Belgien als Kunstrichtung tief verwurzelt, doch in der Politik hat er noch größere Spuren hinterlassen. In Belgien sind 60 Prozent der Bevölkerung niederländischsprachig, 40 Prozent französischsprachig und etwa 100.000 Menschen sprechen Deutsch. Das heutige Belgien ist ein Bundesstaat mit einer niederländischsprachigen Region (Flandern), einer französischsprachigen Region (Wallonien), einer deutschsprachigen Region und der zweisprachigen Hauptstadt Brüssel.
„Historisch“ nennt der Politologe Dave Sinardet von der Freien Universität Brüssel die Tatsache, dass Belgien jetzt einen flämisch-nationalistischen Premierminister hat. Doch jede Region hat ihren eigenen Premierminister, ihre eigene Regierung und ihr eigenes Parlament, mit völlig unterschiedlichen Strukturen und Gesetzen. Ein Leckerbissen für Juristen, ein Leckerbissen für die Bürger … De Wever präsentiert sich gerade als Retter Belgiens, der die Staatsschulden senken und unser Sozialsystem über Wasser halten wird. Das kommt an.
Belgien aus den Schulden führen
Die bunte Truppe aus fünf Parteien will Belgien mit Reformen aus der Verschuldung führen. Eine große Reform des Steuer- und Rentensystems soll die hohe Verschuldung eindämmen. De Wever will damit schaffen, was den Vorgängerregierungen nie gelungen ist. Unmöglich? Nun, als die N-VA 2001 gegründet wurde, hatte niemand damit gerechnet, dass diese Partei einmal den belgischen Premierminister stellen würde. Nie zuvor war es einem flämischen Nationalisten gelungen, Premierminister Belgiens zu werden. Heute, nach fast acht Monaten Verhandlungen, wird er sein erstes Kabinett leiten. Als Regierungschef eines Landes, das er am liebsten auflösen würde, wurde er soeben vor dem König vereidigt – auf Niederländisch, Französisch und Deutsch.
Die belgische Staatsverschuldung betrug Ende August 2024 rund 538 Milliarden Euro. Die Staatsverschuldung Österreichs lag zuletzt im Juni 2024 bei rund 423 Milliarden Euro. Das sind 70 Prozent des BIP in Wien, aber nicht weniger als 105 Prozent des BIP in Brüssel. Hier wird es langsam „griechisch“. Um das richtig zu interpretieren, muss man wissen, dass Belgien mehr als elf Millionen Einwohner hat, die auf einer Fläche von 30.688 km² leben. Zum Vergleich: Österreich hat 9,158 Millionen Einwohner auf 83.841 km². Österreich ist also fast dreimal so groß wie Belgien, hat aber über 20 Prozent weniger Einwohner.
Staatsreform als Lösung
De Wever hat eine klare Vorstellung davon, was er will: „Durch die derzeitige Staatsstruktur verschwenden sowohl Flamen als auch Französischsprachige weiterhin Zeit und Energie. Außerdem sind die föderalen Gelder jetzt aufgebraucht, und wenn nichts geschieht, wird die Rückzahlung der belgischen Schulden auf den Schultern der Flamen lasten. Das können wir nicht länger hinnehmen.“ Unverblümt erklärt er: „Der Konföderalismus ist das erste und wichtigste Ziel unserer heutigen Politik. Die flämische demokratische Mehrheit muss befreit und respektiert werden.“
Die Bürger wollen wissen, wie die neue Regierung die soziale Sicherheit, die Renten und die Landesverteidigung im nächsten Jahrzehnt aufrechterhalten will. Und wie der Haushalt ausgeglichen werden soll. Auf den fünf Parteitagen, auf denen der Koalitionsvertrag verabschiedet wurde, hat jeder etwas bekommen. „Unsere Partei hat eine Mauer errichtet gegen …“, und „ohne uns wäre alles noch schlimmer“. Alle fünf traten in die neue Regierung ein. Unter lautem Beifall stimmten die Abgeordneten einer Vereinbarung zu, die sie nicht lesen konnten, weil die Zeit zu knapp war. Alles muss schnell gehen, keine Zeit zum Nachdenken, keine Zeit für Fragen.
Das Amt des Premierministers ist eine Belohnung für De Wever, der die mühsamen Verhandlungen geführt hat. Die letzte Verhandlung dauerte mehr als 48 Stunden, ohne Unterbrechung. Belgien wird eine strengere Asylpolitik mit Grenzkontrollen einführen. Die Integrationsauflagen werden verschärft und die Polizei erhält die Befugnis, bei Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung Hausdurchsuchungen durchzuführen. De Wever wird auch den Senat abschaffen und wir werden zum ersten Mal eine Regierung ohne Staatssekretäre haben. Minister sollen reichen.
Harte Entscheidungen
Der wichtigste Verhandlungspunkt waren die Finanzen. Vom ersten Tag an war klar, dass Belgien 18 Milliarden Euro einsparen muss, um das Haushaltsdefizit bis 2030 unter drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu drücken, wie es die Europäische Kommission verlangt.
Frühere Kabinette hatten es nie geschafft, die Schulden zu stabilisieren, geschweige denn abzubauen: aus Angst vor harten Entscheidungen, weil die linke Wallonie nicht mitmachte. Dass die rechtsliberale wallonische Partei MR nun die größte Partei in Wallonien ist, macht es für De Wever möglich. Zumindest theoretisch.
Demnächst haben die Belgier nur noch zwei Jahre Anspruch auf Arbeitslosengeld. Das Rentensystem wird reformiert, damit sich längeres Arbeiten lohnt. Eine Steuerreform zielt auf Geringverdiener, die mehr Netto vom Brutto haben werden. Die neue Regierung erhöht die Steuer auf Aktiengewinne auf zehn Prozent.
Die Frage ist, ob die Renditeeffekte nicht zu optimistisch eingeschätzt werden. So geht die Koalition davon aus, dass durch die Senkung des Arbeitslosengeldes und der Steuern 80 Prozent der Erwerbsbevölkerung in Arbeit gebracht werden können. Derzeit sind es nur 70 Prozent. Ökonomen schätzen die realen Chancen dafür als eher gering ein. Es besteht die Gefahr, dass auch die Amortisationseffekte zu optimistisch eingeschätzt werden und neue harte Maßnahmen notwendig werden. Angesichts des hohen gegenseitigen Misstrauens zwischen den Parteien könnte dies schwierig werden. Wir haben in Belgien noch nicht alles gesehen, das ist klar. Vor allem nicht, ob es überleben wird.
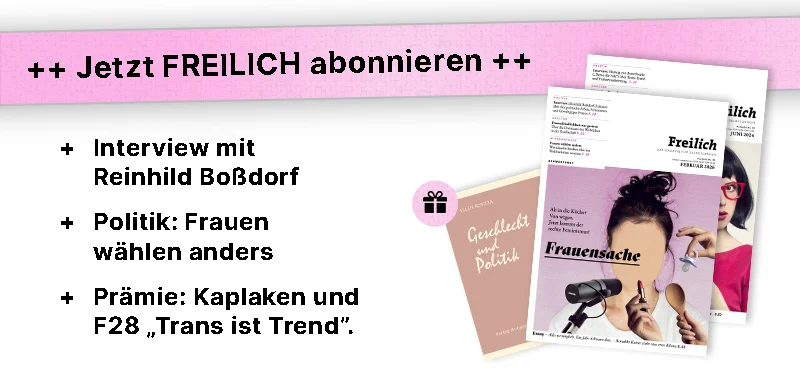

Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!