„Warum haben der Flug zum Mars und die Besiedelung des Mars für SpaceX oberste Priorität? Und wann, glauben Sie, werden Sie bereit sein, eine menschliche Expedition zum Mars zu unternehmen?“ Die Stimme von Frau Weidel scheint auf einer Parabel interplanetarer Umlaufbahnen zu kreisen. Der Futurist Musk beantwortet die Frage mit einem Verweis auf Dinosaurier – sie hatten keine Atomwaffen und sind dennoch ausgestorben. Unsere Spezies, so argumentiert er, sei doppelt bedroht. Deshalb brauche die Menschheit dringend einen Backup-Planeten.
Der Mars als Plan(et) B
Die Kolonisierung des roten Planeten – eingeworfen zwischen Solidaritätsbekundungen zu Israel und metaphysischen Spekulationen über göttliche Transzendenz – war der exzentrischste Moment des Gesprächs, doch das Publikum reagierte mit kühler Zurückhaltung. In einer Zeit, in der der Alltag die Menschen mit seinen Bürden erdrückt, bleibt die Mars-Utopie für die meisten nichts weiter als ein sehnsüchtiges Seufzen über die ausweglose Misere der Erde – ganz im Geist von David Bowie.
Sailors fighting in the dance hall
Oh man, look at those cavemen go
It's the freakiest show
Take a look at the lawman
Beating up the wrong guy
Oh man, wonder if he'll ever know
He's in the best-selling show
Is there life on Mars?
Es ist noch nicht lange her, dass der Traum von der Eroberung des Weltraums Millionen in einen Rausch aus Opferbereitschaft und Schaffenskraft versetzte. Ich spreche vom russischen Kosmismus – geboren aus Fjodorows christlich-monarchistischen Utopien, bei Ziolkowski mit faschistoiden Zügen durchsetzt und schließlich in der Symbiose mit der bolschewistischen Utopie zur treibenden Kraft der sowjetischen Raumfahrtprogramm geworden. So wurde der rote Mythos gekrönt.
Der „Wesir des bolschewistischen Reiches“
Eine markante Rolle spielte dabei Mars, „der rote Stern“ – so benannt im gleichnamigen Roman von Alexander Bogdanow, einem der führenden Köpfe der Bolschewiki. Alexander Malinowskij, alias Bogdanow, war eine explosive Mischung aus Universalgelehrtem und Verschwörer. Ein Denker von seltener Bandbreite: Als Systemtheoretiker, Psychiater und Gründer des ersten Bluttransfusionsinstituts der Welt war er zugleich das „Portemonnaie der Partei“ bei bolschewistischen Umtrieben. Er verstand seine Weltanschauung als revolutionär-wissenschaftlich, lehnte abstrakte Philosophie als bloßen Ausdruck geistiger Schwäche ab und erkannte in Idealismus, Metaphysik und vor allem in der Religion Symptome einer psychischen Krankheit.
Im Herbst 1903 schloss er sich im Alter von 30 Jahren der Partei an; ein Jahr später traf er in Genf auf Lenin. Obwohl Lenin Bogdanows philosophischen Ideen kritisch gegenüberstand, verbündeten sie sich in revolutionären politischen Bestrebungen. Da der Bolschewiführer im schweizerischen Exil verbleiben musste, kehrte Bogdanow mit seinen ausführenden Vollmachten nach Sankt Petersburg zurück – in den Worten des Revolutionshistorikers Pokrowskij als „Wesir des bolschewistischen Reiches“.
Der Bruch zwischen Bogdanow und Lennin
Ein amüsantes Foto aus dem Jahr 1908 zeigt Bogdanow und Lenin bei einem Besuch bei Gorki in Capri. Auf dem Bild, aufgenommen an einem Schachbrett, ist Lenin gähnend zu erkennen. Gorki blickt ihn schmunzelnd an – Erinnerungen zufolge hatte Lenin diese Partie verloren, was ihn in unbändiger Wut zurückließ. So begann eine Phase, in der sich der Riss zwischen den beiden zu vertiefen schien: Ausgerechnet eine finanzielle Meinungsverschiedenheit, die sich in einem hitzigen, beinahe theatralischen Streit über Erkenntnistheorie entlud.
Bogdanow forderte ein systematisches, empirisch fundiertes Verständnis, bei dem Wahrnehmung und Verstand als integraler Bestandteil der materiellen Welt wirken. Lenin hingegen sah darin eine gefährliche Verklärung der Subjektivität – was er in beinahe beleidigender Weise zum Ausdruck brachte.
Ich bin der Meinung, dass die Debatte darüber, ob die Wissenschaft objektive Wahrheiten über die objektive Realität erschließen kann oder ob sie lediglich sozial konstruierte Wahrnehmungs- und Konzeptualisierungsmodelle liefert, auch heute noch von großer Bedeutung ist. Immerhin wurde Bogdanow 1909 aus der Partei ausgeschlossen, und Lenin ergriff die Oberhand über Parteikasse und Presseorgane.
Streben nach längerem Leben
Zur gleichen Zeit arbeitete Bogdanow an seinem Hauptwerk, der „Tektologie“ – einem Versuch, eine universelle Wissenschaft der Organisation zu begründen, die sämtliche Bereiche der Realität – von der Natur über gesellschaftliche Strukturen bis hin zu technischen Systemen – erfasst. Er strebte danach, allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten zu entdecken, die in unterschiedlichsten Systemen wirken, und legte damit den Grundstein für frühe Formen der Systemtheorie und Kybernetik.
Ein weiteres Anliegen Bogdanows war die Verlängerung des Lebens – ein Problem, das er zu lösen suchte, indem er auf die Transfusion von jungem Blut setzte. Mithilfe Stalins gründete er ein Bluttransfusionsinstitut, in dessen Rahmen das junge Blut dazu dienen sollte, wertvolle Parteikader zu verjüngen – ein Programm, das den späteren Adrenochrom-Experimenten der 1950er-Jahre in Amerika vorausging. Tragischerweise endete dieses Vorhaben, als Bogdanow selbst bei einer Transfusion von einem jüngeren Mädchen verstarb.
„Der rote Stern“
Immerhin wollte ich den utopischen Roman „Der Rote Stern“ besprechen, den Alexander Bogdanow 1907 verfasste. Die deutsche Übersetzung von Hermynia Zur Mühlen ist auf der Website von Project Gutenberg verfügbar: The Project Gutenberg eBook of Der rote Stern, by Alexander Bogdanow. Es war zu jener Zeit“, so fängt der Roman an, „da in unserem Lande der gewaltige Zusammenbruch seinen Anfang nahm“.
Der Zusammenbruch betrifft nicht nur gesellschaftliche Strukturen, sondern dringt tief in die zwischenmenschlichen Beziehungen – selbst die familiären Bindungen bleiben nicht verschont. Der Erzähler, ein überzeugter linker Revolutionär, muss miterleben, wie diese Zersetzung auch seine Familie erfasst. Seine Frau, zugleich Parteigenossin, hält strikt an den sozialistischen Moralnormen fest, während seine Ansichten – auch in Bezug auf das Familienleben – zunehmend in nihilistische Tendenzen abgleiten. Hinzu tritt ein Genosse unter dem rätselhaften Pseudonym „Menny“, der mit seinen diskursiven Strategien maßgeblich zum Zerfall der Beziehungen beiträgt.
Reise zum Mars
Der Genosse „Menny“ verführt den Protagonisten, Leonid oder auch Lenny genannt, der unter anderem Naturforscher ist, dazu, einer wissenschaftlichen Geheimgesellschaft beizutreten und an einer Marsexpedition teilzunehmen. So steigt Lenny in ein atomkraftgesteuertes Raumschiff und macht sich auf den Weg. Zu Beginn der Reise zieht Menny seine Maske herunter. Leonid sieht seine riesigen Pupillen und tropfenförmigen Augen – Menny ist ein Marsianer. Das Raumschiff, Aetheronef genannt, fliegt zum Mars, wo eine utopische kommunistische Gesellschaft existiert.
Der Mars ist eine hochentwickelte kommunistische Gesellschaft ohne Klassen, Privateigentum oder Ausbeutung. Wissenschaft und Technologie sind weit fortgeschritten, und die Produktion wird zentral und planmäßig gesteuert. Die Marsianer besitzen nichts, sind damit aber glücklich.
Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind minimal, da es weder „häusliche Sklaverei der Frau“ noch „das Schuften des Mannes“ gibt. Ihr Privatleben gestalten sie polyamor und genderfluid. Euthanasie wird als soziale Praxis akzeptiert. Als Speerspitze der evolutionären Entwicklung sehen die Marsianer die Fortpflanzung als essenzielle Pflicht an. Ihr Denken liegt damit näher an Elon Musk als an Klaus Schwab.
Wohin ausweichen?
Immerhin führt die natalistische Expansion zur Ausschöpfung der Ressourcen des Planeten. Daher sehen sich die marsianischen Genossen gezwungen, eine interstellare Spezies zu werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: die Kolonisierung der Venus, wo jedoch starke Sonnenstrahlung und schädliche Viren herrschen, oder die Erde, die über alle notwendigen Ressourcen verfügt – allerdings mit einer entscheidenden Herausforderung: der zurückgebliebenen, chauvinistischen Bevölkerung.
An dieser Stelle erlaube ich mir eine Anekdote. Ich bin auf einem Schiff und unterhalte mich mit einem britischen Marineoffizier.
„Where are you from?“ fragt er mich.
„From Karelia,“ antworte ich.
„It’s a bad place.“ – Der Herr weiß also bereits, welche Orte auf der Erde gut und welche schlecht sind.
„Why? The nature there is beautiful.“
„Nature is beautiful everywhere … but the people …“
Ja, die Ausrottung der Menschheit zugunsten des überlegenen queeren marsianischen Kommunistenschwarms wird im Roman in Erwägung gezogen. Weiteres werde ich nicht spoilern – die Lektüre steht Ihnen frei.
Vom Mond zum Mars
In seiner Antrittsrede am 20. Januar 2025 erklärte Präsident Donald Trump: „Wir werden unser festgeschriebenes Schicksal, nach den Sternen zu greifen, erfüllen und amerikanische Astronauten losschicken, um die Stars and Stripes auf dem Planeten Mars aufzustellen.“ Dieses ambitionierte Ziel, amerikanische Astronauten zum Mars zu entsenden, wurde von Persönlichkeiten wie Elon Musk und Jeff Bezos unterstützt, die mit ihren Raumfahrtunternehmen maßgeblich an der Verwirklichung solcher Missionen beteiligt sind. Allerdings bleibt abzuwarten, ob dieses ehrgeizige Vorhaben innerhalb der aktuellen Amtszeit realisiert werden kann, da die NASA zunächst plant, bis 2027 Menschen im Rahmen der Artemis-3-Mission zum Mond zu bringen.“
Wir alle haben Aufnahmen von der Gründung der amerikanischen Freimaurerloge auf dem Mond gesehen, wo eine Sternenflagge in Abwesenheit jeglicher Atmosphäre im sternlosen Himmel weht, aber der Mars ist nicht der Mond, das ist ein ganz anderer Planet.
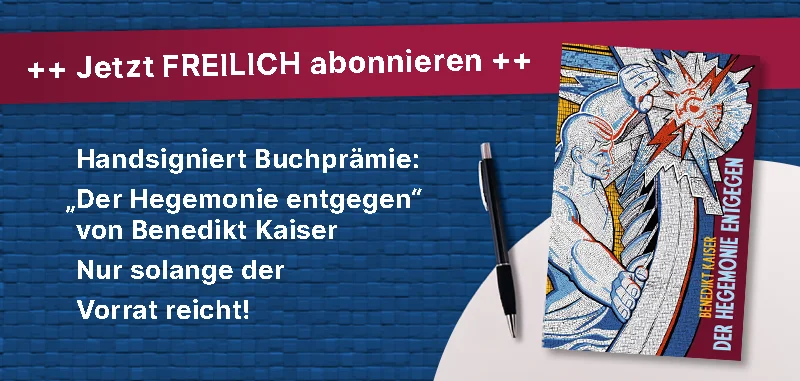
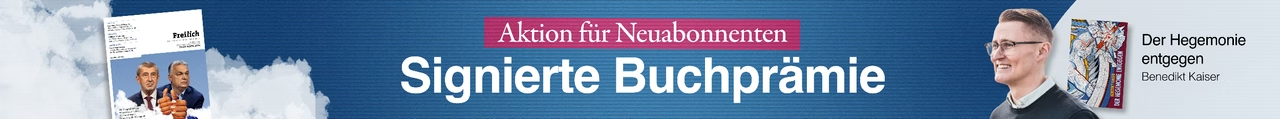


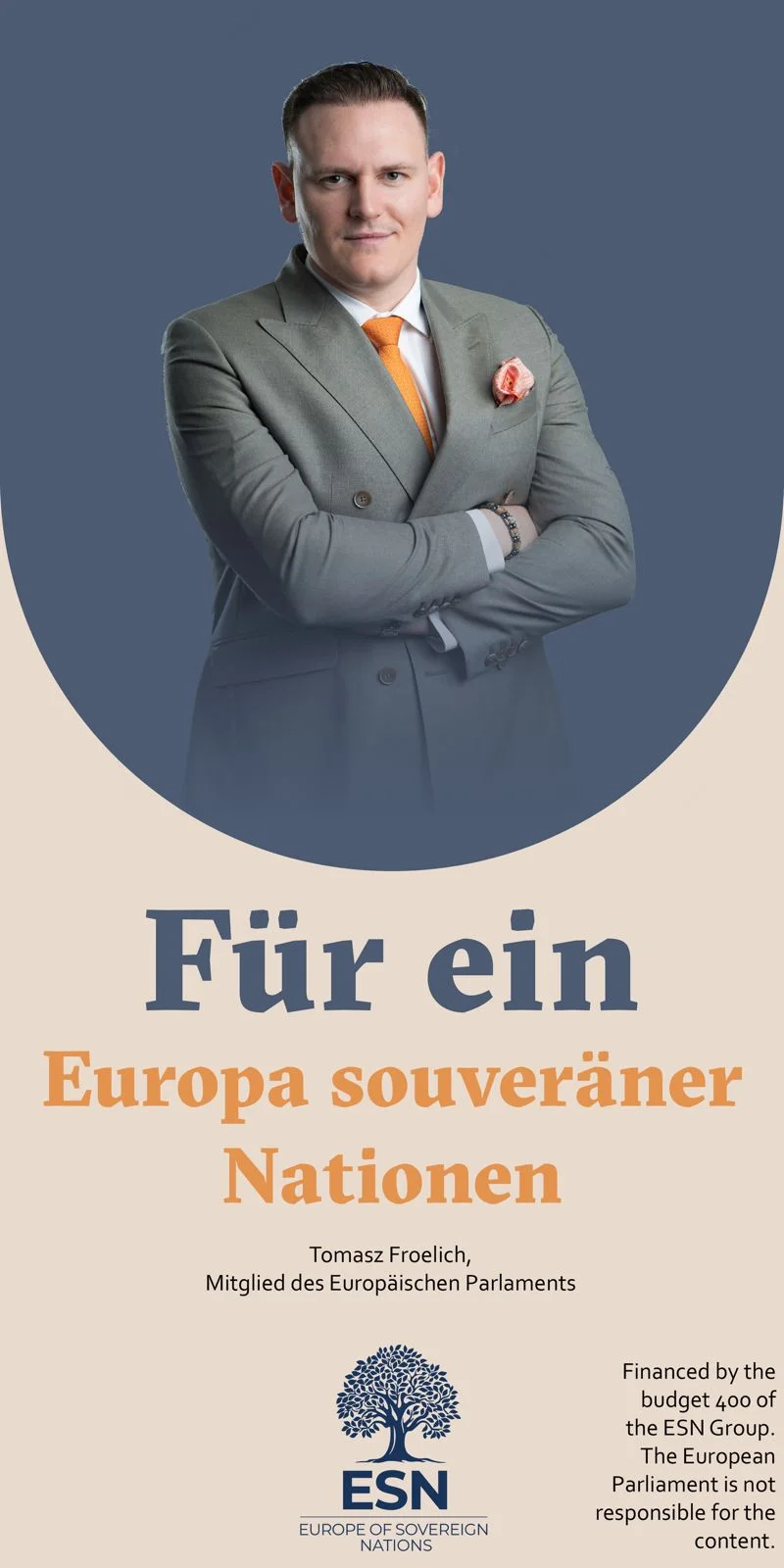

Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!