FREILICH: Sehr geehrter Herr Kinzel, Ihr Standardwerk Nicolás Gómez Dávila. Parteigänger verlorener Sachen wurde dieses Jahr bereits in seiner 5. Auflage veröffentlicht. Der Titel ist sprechend: Dávila monierte, wie schon Donoso Cortés vor ihm, den Verlust der Einheit von geistlicher und weltlicher Macht im Abendland. Anders als zu Zeiten des letzteren, war zu Lebzeiten Dávilas jegliche Hoffnung auf Restauration dahin.
Das sah auch sein Zeitgenosse Reinhold Schneider so, der für eine Rückkehr der Krone in die Realpolitik die nötigen geistig-ethischen Grundlagen nicht mehr gegeben sah. Heute gilt dies nicht weniger. Wie war das bei Dávila? Die meisten werden vor allem seine Scholien kennen, in denen er die parlamentarische Demokratie scharf kritisierte. Doch was war eigentlich Dávilas realistische politische Option? Oder war er als Reaktionär am Ende gar apolitisch?
TIll Kinzel: Gómez Dávila war zwar einerseits politischer Realist in dem Sinne, wie Thukydides, Montaigne oder Jacob Burckhardt Realisten waren – sie alle wussten, was vom Menschen zu erwarten ist, sie wussten, was die Macht und vor allem der Bürgerkrieg mit den Menschen macht und wie labil letztlich auch eine gute politische Ordnung sein kann.
Und Gómez Dávila war sich natürlich im Klaren darüber, dass das Königtum eine mythische oder zumindest poetische Kraft entfalten kann, wenn es auch keine im eigentlichen Sinne politische Bedeutung mehr hat. In den hintersten Winkeln der Seele würde jeder die Poesie des geflüchteten Königs der Rhetorik des siegreichen Proletariers vorziehen, sagte er einmal. Denn Gómez Dávila war nie ein sogenannter Realist in dem Sinne, dass er sich dem pragmatischen Programm einer Partei verschrieben hätte.
Als jemand, der sich selbst mit der Figur des „Reaktionärs“ identifizierte, entschied er sich tatsächlich dafür, ein Parteigänger von Dingen zu sein, die sich nicht restaurieren lassen – außer vielleicht in der Seele des Einzelnen, der sich an ihre Schönheit und Würde erinnert. Als Reaktionär bekannte er sich zur Nostalgie, der Sehnsucht nach dem vergangenen Schönen, aber er hätte es als frivol empfunden, mittels einer politischen Bewegung die Dinge gerade rücken zu wollen – denn politische Bewegungen müssen, um Erfolg zu haben, populär sein – und das ist bereits auch der Keim ihres Scheiterns, weil sie sich dann nicht von der Lüge im Dienste der Zweckmäßigkeit beziehungsweise aus der „Verantwortung“ freihalten können.
Ihr Werk feiert inzwischen sein 20-jähriges Jubiläum. Wie empfanden Sie die Resonanz darauf in diesen zwei Jahrzehnten? Ist das Interesse an dem Werk Dávilas Ihrem Eindruck nach seitdem gestiegen? Immerhin gab es einen von Michael Klonovsky herausgegebenen Reclam-Band, welcher reaktionäre Philosoph hätte das noch vorzuweisen?
Die einigermaßen erstaunliche Resonanz auf mein Buch, mit der vor zwanzig Jahren keinesfalls zu rechnen war, ist nur ein kleiner Teil der Resonanz, die sich vor allem dem Werk Gómez Dávilas selbst verdankt. Dem Wiener Karolinger Verlag kommt hier das entscheidende Verdienst zu, sich für dieses Werk stark gemacht zu haben.
Ich bin durch meine frühe Beschäftigung mit dem kolumbianischen Denker und Schriftsteller in Kontakt zu zahlreichen Menschen aus verschiedenen Ländern gekommen, angefangen mit Martin Mosebach, der einer der ersten Propheten von Don Nicolás in europäischen Gefilden war, und dem italienischen Philosophen Franco Volpi bis zu der Ende 2022 verstorbenen Tochter des Philosophen, Rosa Emilia Gomez de Restrepo. Inzwischen gibt es eine junge Generation kolumbianischer Studenten und Doktoranden, die in ihrem Landsmann einen inspirierenden Denker erkannt haben, der weit entfernt ist von den Hauptströmungen des akademischen Betriebs in der westlichen Welt.
All das war vor 20 Jahren noch kaum denkbar und lag in weiter Ferne. Aber die große geistige Freiheit, die Gómez Dávila nicht nur verkörperte, sondern auch in seinen Lesern weckte oder in Erinnerung ruft, ist ein Geschenk, das sich auf oft überraschenden Wegen ergeben hat. Und so bin auch im Laufe der Jahre immer wieder auf Menschen gestoßen, die sich als Gómez Dávila-Leser zu erkennen gaben, so dass man vielleicht von einer geheimen Bruderschaft sprechen kann, die sich an seinen Winken und Anspielungen wärmt und nährt.
Ihre Anhänger finden sich heute weit verstreut, nicht nur in Österreich, Deutschland und Italien (wo auch mein Buch übersetzt wurde), sondern auch in Ungarn, Frankreich, in den Niederlanden, Polen, Russland und den USA. Das ist ein Zeichen für das Unbehagen in der Moderne, für das es viele gute Gründe gibt – denn nicht jeder ist bereit zu glauben, dass wir hier und jetzt in der besten aller möglichen Welten leben. Und so hält es auch das Denken Gómez Dávilas lebendig, wenn sich inzwischen andere Autoren wie Vittorio Hösle, Detlev Piltz oder Richard Reschika oder zuletzt Ramon Elani in den Vereinigten Staaten dadurch zu eigenen Büchern anstoßen ließen.
Es hat sich jedenfalls gezeigt, dass die Lektüre von Gómez Dávila – und vielleicht auch ein bisschen die meines Buches – dazu beigetragen hat, der geistigen Freiheit Raum zu verschaffen in einer Welt, die von politisch korrekten Phrasen und Automatismen beherrscht wird und in der es großer Anstrengungen bedarf, sich dem täglichen Dauerfeuer der Propaganda zu widersetzen, die der Fluch der Moderne ist. Dieser Erfolg Gómez Dávilas war schon im höchsten Maße unwahrscheinlich – und er ändert, vorerst, nichts im Großen. Aber gerade das Unwahrscheinliche seines Erfolges lehrt, dass der Mensch nicht dauerhaft sein Bedürfnis nach Schönheit und Weisheit verleugnen kann.
In Ihrem Essay „Die Kunst der Krisenklugheit“ (Sezession 100, Februar 2021) betonten Sie, dass es angesichts der krisenhaften Wirklichkeit nicht mehr genüge, „zu Carl-Schmitt-Exzerpten zu greifen“. Stattdessen müsse „die ganze Tradition in ihrer historischen, philosophischen und religiösen Tiefe angezapft und neu erschlossen werden“.
In Europa erleben wir derzeit ein Widererstarken der Rechten, aber zapft sie die von ihnen genannten Quellen und Denker hinreichend an oder verengt sie sich nicht vielmehr aufs tagespolitische Sichtfeld und bleibt dabei eklektizistisch und in geistlicher Hinsicht postmodern-steril?
Diese Frage betrifft ganz wesentliche Probleme. Zunächst: Ich sehe nicht, dass sich an der Notwendigkeit einer Krisenklugheit etwas geändert hat, nur muss man heute wohl noch schärfer sehen, dass diejenigen, die die Szenerie der Politik beherrschen, nicht nur selbst wenig Krisenklugheit besitzen, sondern im Gegenteil die Krisen nach Kräften und Möglichkeiten befeuern.
Das bewirkt, dass niemand mehr wirklich zu Atem kommt, denn wenn es nicht Corona ist, das alle umtreiben soll, sind es internationale Konflikte und die Migration oder doch wieder das Klima. In keinem dieser Felder kann man erkennen, dass irgendwelche operationalisierbaren, also praktikablen, Ansätze verfolgt werden – was aber für Gómez Dávila geradezu ein Zeichen politischer Reife wäre. Derzeit aber herrschen wieder utopische Impulse, als ließen sich durch politischen Interventionismus globale Wetterlagen (diverser Art) nachhaltig steuern.
Was nun die Frage nach der geistigen Auseinandersetzung im Bereich der politischen Kräfte betrifft, die in der einen oder anderen Form gegen zentrale Projekte der Linken opponieren, so fehlt mir hier der nötige Blick hinter die Kulissen der doch sehr unterschiedlichen Parteien in den verschiedenen Ländern Europas. Doch lässt sich der Verdacht wohl nicht ganz von der Hand weisen, dass allzu oft kurzatmige Tagespolitik das Feld dominiert und grundsätzliche Fragen auf der Strecke bleiben. Die Gründe dafür sind sicher vielfältig, auch weil den maßgeblichen Politikern im Alltag wenig Zeit zu Lektüre und Reflexion bleibt.
Aber da Politikberatung bekanntlich nur dort erfolgreich sein kann, wo kein politischer Wille entgegenwirkt, kommt viel darauf an, intellektuelle Neugierde und Regsamkeit im Vor- und Umfeld von konservativen Parteien zu fördern. Denn nur so können auch kreative Antworten auf die tatsächlichen und inszenierten Krisen entwickelt werden, die nicht wieder selbst zur Verschärfung der Probleme führen. Außerdem bedarf es einer ständigen Schärfung der Begriffe und damit des eigenen Denkens, denn wer die Begriffe aus der Sprache des Gegners übernimmt, hat schon verloren.
Schließlich müsste auch in der Politik selbst ein Bewusstsein dafür (wieder) geweckt werden, dass Politik nicht alles ist und nicht totalitär werden darf. Der Zugriff auf Gesinnungen muss ihr verwehrt werden – hier kann uns das störrische Denken eines Reaktionärs wie Gómez Dávila zum Muster dienen, auch und gerade weil er keine wohlfeile Antwort auf die alles beherrschenden Fragen des Tages bietet.
Dávila war gleichsam kein Reaktionär aus Prinzip oder Nostalgie, sondern Katholik. Im deutschen Katholizismus erleben wir derzeit aber vielmehr Säkularisierung, Verschwörung gegen den Heiligen Stuhl und Austrittswellen. Was kann die deutsche Kirche von Davilá lernen?
Gómez Dávila war Katholik, aber er war sehr wohl auch prinzipieller Reaktionär und als solcher Nostalgiker. Aber ein Nostalgiker, der erstens weiß, dass hienieden mehr vergänglich ist, als man denken mag. Das kann auch diejenigen geistigen oder spirituellen Moden betreffen, die in einem an Weltgeltung verlierenden Deutschland noch grassieren. Aber Gómez Dávila verstand sich selbst als Repräsentant einer Wahrheit, die nicht stirbt – was stirbt, sind die Träger von Ideologien.
Die Anpassung an den Zeitgeist, der sich auch in den Kirchen breitmacht, hat Gòmez Dávila scharf gesehen – denken Sie daran, dass er polemisch mit dem II. Vatikanischen Konzil einen „Feuerbach“ auf die Kirche niedergehen sah – womit er auf jenen deutschen Philosophen anspielte, der die Religion mittels einer sogenannten „anthropologischen Reduktion“ aufheben wollte, indem er das Menschliche am Göttlichen in den Vordergrund rückte.
Für Gómez Dávila war Gott aber so nicht in den Griff zu bekommen – wie er überhaupt den Versuch ablehnte, Gott auf den Begriff zu bringen. Denn ein verstandener Gott ist kein Gott. Gómez Dávila verstand sich als einfacher Katholik, nicht als Theologe, ihm war die Frömmigkeit der Bäuerin näher als der Hochmut von Theologen, die vorgeben zu wissen, was Gott will. Insofern kann Gómez Dávila ein Beispiel für Demut bieten, aber, und das ist vielleicht paradox, einer Demut, die sich nicht den Mund verbieten lässt. Und vielleicht darf man hier an einen der scharfen Sätze Gómez Dávilas erinnern: „Der Tod Gottes ist eine interessante Meinung, aber sie betrifft nicht Gott selbst.“ Dazu müsste sich auch die Kirche entsprechend verhalten, und auch wenn Verzweiflung manchmal eine naheliegende Reaktion auf die Phänomene des Zeitgeistes ist, darf sie nie das letzte Wort sein.
Zur Person:
Till Kinzel wurde 1968 in Berlin geboren. Nach dem Studium der Geschichte und Anglistik promovierte er 2002 mit einer Arbeit über Platonische Kulturkritik in Amerika. Er habilitierte sich 2005 an der Technischen Universität Berlin mit einer Arbeit über Philip Roth.


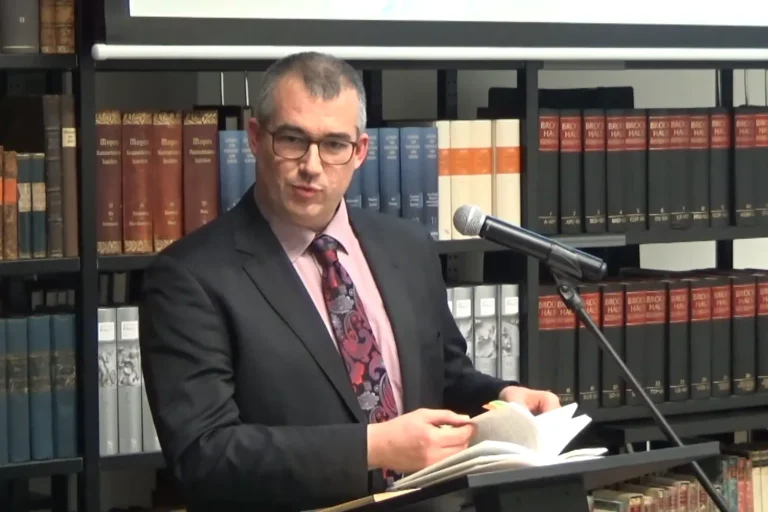

Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!