Die Alternative für Deutschland (AfD) ist weit mehr als eine politische Partei. Sie gleicht einem Spiegel, der die innersten Brüche und Widersprüche der deutschen Gesellschaft offenlegt. Doch zugleich ist sie auch ein Prisma, durch das sich neue Perspektiven und Möglichkeiten entdecken lassen, die in der oft erstarrten politischen Landschaft Deutschlands lange Zeit verborgen blieben. Die AfD steht im Zentrum von Spannungen zwischen Ost und West, zwischen historischen Prägungen und modernen Herausforderungen sowie zwischen unterschiedlichen Vorstellungen von Demokratie und nationaler Souveränität. Genau hier liegt ihre doppelte Natur: als Symptom einer gespaltenen Nation und als potenzieller Katalysator für einen neuen Dialog.
Der politische Kontext: Die AfD und die „Berliner Republik“
Die AfD ist ein Kind der Krise – einer Krise, die tief in der Geschichte der sogenannten „Berliner Republik“ verwurzelt ist. Nach der Wiedervereinigung genoss Deutschland eine Phase scheinbarer Stabilität und wirtschaftlichen Wachstums. Doch hinter dieser Fassade lauerten Konflikte und Spannungen, die spätestens mit der Euro-Rettungspolitik, der „Energiewende“ und der Flüchtlingskrise von 2015 unübersehbar wurden. Institutionen wirkten träge, Parteien verhedderten sich in inhaltlicher Ideenlosigkeit, und das Vertrauen der Bürger in die politische Klasse begann zu schwinden.
In genau diesem Moment trat die AfD auf die Bühne – nicht als Randerscheinung, sondern als deutliche Reaktion auf das Versagen der etablierten Parteien. Ihre Gründung war weniger eine Wahl als vielmehr eine Notwendigkeit, eine Konsequenz aus der wachsenden Kluft zwischen Volk und politischen Eliten. Ihre Programmatik wurde wie von selbst zur Anklage gegen die vermeintliche Alternativlosigkeit etablierter Politik.
Ost und West: Zwei „gelernte“ Narrative und Elektorate
Die Wiedervereinigung liegt über 30 Jahre zurück, doch die Wunden und mentalen Unterschiede zwischen Ost und West sind noch immer nicht verheilt. Wie Stefan Mau in seinem Buch „Ungleich vereint“ beschreibt, sind die mentalen, kulturellen und politischen Gräben tief und beeinflussen bis heute das Verhalten und die Einstellungen der Menschen in beiden Teilen des Landes. Diese Unterschiede ebnen sich auch nicht ein, sondern verstetigen sich in den jeweiligen Milieus. Dieser Prozess spiegelt sich so auch in der AfD wider.
Im Osten ist die AfD deutlich stärker, häufig Ergebnis eines Gefühls der politischen und sozialen Marginalisierung. Hier ist die Partei ein Ventil für jene, die sich nach der Wende entwurzelt und von der Politik im Stich gelassen fühlen und für verbliebene Leistungsträger, die ihre Aufbauleistung aufgrund der falschen Weichenstellungen bei Migration und Energiepolitik gefährdet sehen. Ihre Erfolge in Ostdeutschland sind auch ein Echo auf das Trauma des wirtschaftlichen Umbruchs, das viele Familien zerrissen hat. Im Westen hingegen mobilisiert die AfD eher konservative Milieus, die sich gegen eine als überzogen links-liberal empfundene Gesellschaftspolitik wenden. Anders als im Osten gab es in den Westbiographien praktisch kaum kollektiv-gesellschaftlichen oder individuell-persönlichen Anpassungsdruck
Diese Spannungen erzeugen nicht nur innere Konflikte, sondern auch wechselseitige Vorurteile. Ostdeutsche werfen Westdeutschen vor, naiv und blind gegenüber der Notwendigkeit grundlegender Veränderungen zu sein. Umgekehrt sehen viele Westdeutsche den Osten als rückständig und undankbar. Begriffe wie „Dunkeldeutschland“ sind nicht nur herablassend, sondern ignorieren auch die immensen Anpassungsleistungen, die Ostdeutsche seit der Wiedervereinigung erbringen mussten. Diese gegenseitigen Missverständnisse wirken bis in die inneren Strukturen der AfD hinein, wo sich die unterschiedlichen politischen Kulturen und Milieus immer wieder reiben, auch weil sie – anders als bei den anderen Parteien – medial massiv einseitig ausgeschlachtet werden.
Die Herausforderung der AfD: Integration statt Spaltung
Die AfD steht als gesamtdeutsche Partei vor einer zentralen Aufgabe: Sie muss die tiefen Gräben zwischen Ost und West bewusst und proaktiv überbrücken. Es reicht nicht, eine Seite zu bevorzugen, zu überhöhen oder medial zu übersteuern. Stattdessen müsste sie beiden Perspektiven gerecht werden und Raum für gegenseitiges Verständnis schaffen:
Für die Ostdeutschen: Sie müssen verstehen, dass das westdeutsche Zögern in außenpolitischen Fragen keine bloße Naivität ist, sondern tief in der Nachkriegsgeschichte verwurzelt liegt. Die im Rahmen der „reeducation“ langfristig eingebrannte transatlantische Orientierung des Westens mag langsam erodieren, doch dieser Prozess ist ein schmerzhafter und komplexer.
Für die Westdeutschen: Sie sollten die spezifischen Herausforderungen und die Resilienz der Ostdeutschen anerkennen, die nicht nur wirtschaftliche, sondern auch kulturelle und gesellschaftliche Umwälzungen meistern mussten. Eine pauschale Abwertung à la „Dunkeldeutschland“ ignoriert die Tiefe und Legitimität ostdeutscher Kritik.
Hier hat die AfD die Chance, nicht nur Protestpartei zu sein, sondern die Pflicht, eine aktive Brückenfunktion im wechselseitigen Verständnis zu übernehmen. Sie muss ein Forum bieten, in dem diese beiden Narrative nicht gegeneinander ausgespielt, sondern miteinander versöhnt werden, insbesondere, was die medial immer gerne ausgespielte und gegen die AfD ins Feld geführte außen- und verteidigungspolitische Frage der geopolitischen Einbindung betrifft.
Die politische Klasse und die Brandmauer
Die Reaktion der etablierten politischen Klasse auf die AfD ist schlicht hilflose Ausgrenzung. CDU, SPD, Grüne, FDP und Linke haben eine „Brandmauer“ gegen die AfD errichtet, die jede Zusammenarbeit kategorisch ausschließt. Diese Haltung verkennt, dass die AfD Ausdruck realer gesellschaftlicher Konflikte ist, die nicht durch Tabuisierung gelöst werden können. Darüber hinaus ist die diffamierende Ausgrenzung kontraproduktiv, da sie vom Machtkartell enttäuschte Wähler nachgerade zur Solidarisierung mit der AfD und in ihre Arme drängt.
Chantal Mouffes Konzept der agonalen Demokratie liefert hier eine wichtige Orientierung. Sie unterscheidet zwischen agonaler und antagonistischer Politik: Agonale Demokratie akzeptiert Konflikte als notwendige und produktive Bestandteile des politischen Prozesses. Antagonische Politik hingegen versucht, Konflikte durch die Ausgrenzung bestimmter Akteure zu eliminieren. Die deutsche Strategie gegen die AfD ist eindeutig antagonistisch – und damit langfristig zum Scheitern verurteilt. Statt die AfD als Feind (im Sinne der Kategorie von Carl Schmitt) der Demokratie zu brandmarken, sollte und muss sie in den demokratischen Diskurs eingebunden werden.
Gerade ein Blick auf das europäische Ausland zeigt, dass dies möglich ist: Parteien rechts der Mitte sind in Ländern wie Schweden, Italien und Polen längst politische Normalität und übernehmen Regierungsverantwortung. Indem Deutschland jedoch 20 bis 30 Prozent des Wählerpotentials systematisch aus dem politischen Diskurs ausschließt, vertieft es die gesellschaftliche Spaltung und untergräbt zurecht das Misstrauen in die etablierten Institutionen.
Doch die politische Klasse weiß tief im Inneren, dass die AfD ein historisch-strukturelles Phänomen sui generis ist. Sie ist Ausdruck der Krise der Postdemokratie und ein Symptom jener Defizite, die in den etablierten Parteien kaum mehr aufgearbeitet werden. Der Versuch, die AfD aus dem Diskurs zu verdrängen, ist daher nicht nur strategisch kurzsichtig, sondern auch unehrlich. Mittel- und langfristig kann es keinen Sinn ergeben, sich gegen die normative Kraft des Faktischen zu stellen. Die Integration der AfD und ihrer Wählerschaft in den politischen Prozess ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Wer dies ignoriert, handelt nicht im Sinne einer wehrhaften Demokratie, sondern schwächt ihre Grundlagen.
Die Spaltung überwinden
Die AfD ist gekommen, um zu bleiben. Sie ist keine Randerscheinung, sondern ein Brennpunkt der gesellschaftlichen und politischen Veränderungen, die Deutschland im 21. Jahrhundert prägen. Doch ihre Rolle in der deutschen Politik kann prozessual demokratietheoretisch produktiv nur gestaltet werden, wenn sie als Teil des demokratischen Prozesses anerkannt wird. Genauso liegt es an der AfD selbst, die inneren narrativen Spaltungen zwischen Ost und West einerseits zu erkennen, anzuerkennen und dann zu überwinden und als Brücke zu verstehen. Sie müsste es aus eigenem Interesse besser als die anderen Parteien können, will sie das immer noch nicht gehobene weiterführende Potenzial im Westen heben: Denn noch untergräbt die jahrelange medial eingehämmerte Dämonisierung ein stabiles Grundvertrauen der Deutschen gegenüber der AfD im Westen, ganz anders als im Osten.
Mit Scholzens Vertrauensfrage ändert sich nunmehr strukturell die Vertrauenslage, wenn die Wähler nach der Wahl erkennen müssen, dass es keine Wahl für einen echten Politikwechsel gegeben haben wird. Dann bricht sich der Vertrauensverlust ins Machtkartell bahn. Die politische Klasse steht vor der entscheidenden Frage: Will sie die Spaltung weiter vertiefen, indem sie die AfD isoliert, oder hat sie den Mut, sich den zugrunde liegenden tiefen Widersprüchen der falsch gestellten politischen Weichen der letzten Jahrzehnte (Eurorettung, Klimarettung, Flüchtlingsrettung, alles ohne Wenn und Aber) konstruktiv zu stellen?
Ein ehrlicher, inklusiver Dialog ist der einzige Weg, die wachsende inner-gesellschaftliche Kluft zu überwinden, die sich aufgrund des sich beschleunigenden und verstetigenden wirtschaftlich-industriellen Abstiegs Deutschlands weiter aufstaut. Die deutsche Politik braucht keinen Wettbewerb der Ausgrenzung, sondern eine neue Kultur der Einbindung, ein Prozess, der in den Ländern schleichend und inoffiziell zu beginnen scheint. Nur so kann die Spaltung überwunden und das volle Potenzial einer dann auch tatsächlich gesamtdeutsch vertretbaren Politik ausgeschöpft werden. Selbst wenn bei den anstehenden Wahlen 2025 jetzt noch keine Anzeichen in diese Richtung erkennbar sind, wird es noch in der kommenden Legislaturperiode, sowohl in den Ländern, als auch im Bund, zum Schwur kommen.
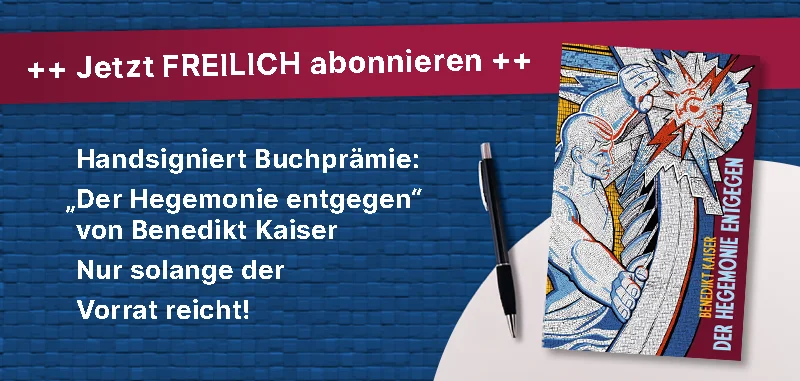




Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!