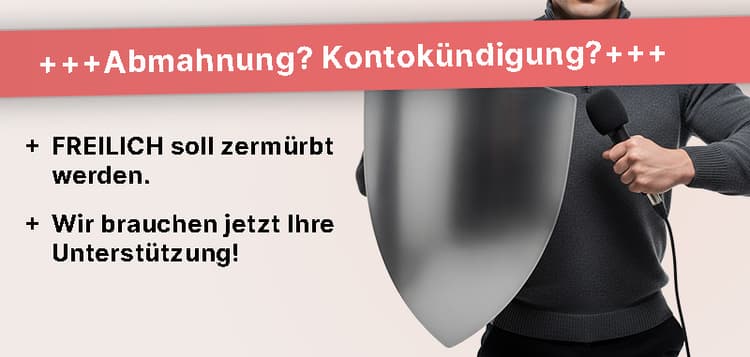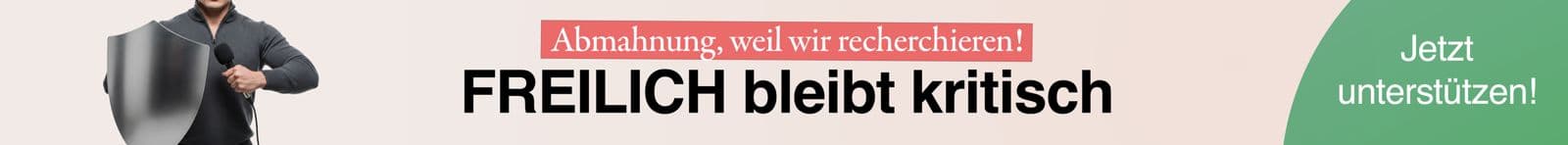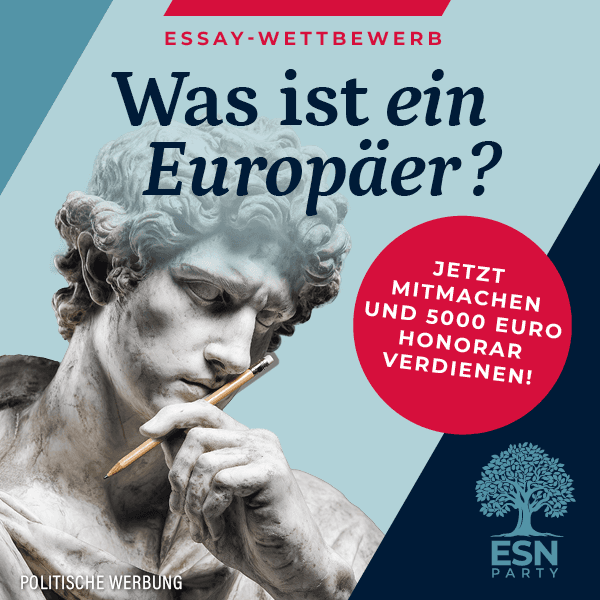Zwischen Kultfigur und Massenverbrecher: Stalins Schatten wächst zurück ins Heute
Stalins steinernes Erbe kehrt nach Moskau zurück – und mit ihm die Debatte über Personenkult, Gewalt und historische Mythen. Ilia Ryvkin zeigt in seinem Beitrag, wie die Wiederbelebung der Stalin-Verehrung zwischen Denkmalkult und brutaler Vergangenheit schwankt.
Vater der Völker. Triumphierend auf seinem Podest, die Brust geschwellt wie ein stolzer Gockel, reckt er die Fahne in seiner Hand empor, als wolle er den Himmel selbst zum Schweigen bringen! Mit einem Blick, der durch die Ewigkeit bohrt, steht er da, die Uniform strahlend wie ein frisch polierter Panzer, umgeben von seiner treuherzigen Menge – Männern, Frauen und Kindern. „Den Sieger richtet man nicht.“ Mit Blumen und Fahnen, während im Hintergrund stilisierte Kreml-Türme aufragen. Der Schnurrbart – ein eigenständiges Relief im Relief, ein perfekt gestutztes Statement, das inmitten der jubelnden Figuren leise von einer georgischen Melodie zu flüstern scheint. Ein Bildnis so pathetisch, dass man fast erwartet, er würde gleich vom Stein springen und eine Hymne an sich selbst anstimmen!

Stalin-Relief in Moskaus Metro
Dieses Relief stellt Joseph Stalin dar und war Teil der Moskauer Metro, insbesondere in Stationen wie Semenovskaja oder Taganskaja, die während des Zweiten Weltkriegs propagandistische Elemente aufwiesen. Es wurde in den 1960er-Jahren während der Entstalinisierung entfernt, doch 2025 wurde eine Replik in Taganskaja wiedererrichtet, was kontroverse Debatten über historische Hommage versus Restalinisierung auslöste.
„Alle positiven Ergebnisse der Stalin-Zeit wurden zu einem inakzeptablen Preis erkauft. Repressionen sind kein Mittel des Erfolgs. In dieser Zeit gab es nicht nur einen Personenkult, sondern auch Massenverbrechen am eigenen Volk.“ – Worte, die nicht von einem westlich orientierten Liberalen, nicht von einem Dissidenten und auch nicht von einem russischen Nationalisten stammen, sondern von Wladimir Putin persönlich. Sie standen auf einem Plakat, das Gegner des wiedererrichteten Stalin-Reliefs an der Metrostation Taganskaja in Moskau aufstellten. Ein weiteres Poster zitierte den Ex-Präsidenten Dmitri Medwedew: „Stalins Handeln verdient die härteste Bewertung.“ Gleichzeitig wurde das Relief landesweit zur Pilgerstätte für Stalin-Vereher. Vor dem roten Generalissimus stapeln sich Rosen und Nelken – stille Rituale eines wiederauflebenden Personenkults.
Hundert neue Denkmäler – ein Trend von unten
Das von der Direktion der Moskauer Lenin-U-Bahn wiedererrichtete Monument ist kein Einzelfall. Zwar sind die genauen Zahlen schwer zu fassen, doch nach verfügbaren Informationen wurden in den letzten Jahren rund 100 bis 123 Stalin-Denkmäler in Russland neu errichtet. Allein im Mai 2025 wurden sieben neue Statuen eingeweiht – ein Rekord.
Die Initiative kam vorwiegend von unten. Viele Denkmäler – etwa das acht Meter hohe Stalin-Monument in Welikije Luki 2023 – entstanden aus privaten Mitteln, oft gegen den Widerstand lokaler Behörden. Historiker weisen darauf hin: Seit 2014 tragen über 90 Prozent der aktuell etwa 123 Denkmäler linkspatriotische Gruppen, Kommunisten und private Spender. Der Staat spielt dabei nur den stillen Dulder, ohne offizielle Verantwortung zu übernehmen.
Mythos Stalin und die Politik des Kremls
Das rote Ressentiment in den breiten Volksmassen überschneidet sich teilweise mit den Kreml-Narrativen: Unter Stalin herrschte das Sowjetreich mit harter Hand, eine konservative kulturpolitische Wende wurde eingeleitet, und die glühende Russophobie der frühen Bolschewiki wurde ab dem Zweiten Weltkrieg durch patriotische Rhetorik abgemildert – der multikulturelle Charakter des Staates blieb jedoch erhalten. All dies passt gut zur Politik des heutigen Kreml.
Andererseits zeigt das mythologisierte Stalin-Bild ihn als asketischen Volksfürsorger, dessen Repressionen angeblich nur „diese korrupten Schweine da oben“ trafen – eine Vorstellung, die sich aus keiner verlässlichen Quelle belegen lässt. Unter den einfachen Leuten ließen die Sozialingenieure vom Präsidialamt am Alten Platz in Moskau diese Version aber nur widerwillig verbreiten.
Von roten Fahnen zu neuen Symbolen
Die Wiederbelebung der Stalin-Verehrung wird von Beobachtern oft als Symptom einer schleichenden Resowjetisierung Russlands gedeutet. Zu Beginn des Militäreinsatzes in der Ostukraine tauchten immer wieder Bilder auf, auf denen in von russischen Truppen besetzten Ortschaften rote Fahnen gehisst wurden. Damit wollte man offenbar signalisieren, dass es sich nicht um einen Konflikt zwischen zwei auf den Ruinen der Sowjetunion entstandenen Staaten – der Russischen Föderation und der Ukraine – handelt, sondern um die „Befreiung“ dieser Orte im Namen einer sowjetischen Identität von einer westlichen „Nazi-Besatzung“.
In den letzten Monaten ist die rote Fahne jedoch zunehmend von der großrussischen Reichsflagge Schwarz-Gelb-Weiß, dem Christusbanner und vor allem vom russischen Nationaltrikolor Weiß-Blau-Rot abgelöst worden. Offenbar lässt sich die Rote Fahne heute weder als Symbol für Klassenkampf noch für ein längst vergangenes Imperium sinnvoll einsetzen – weder für Opferbereitschaft noch für Befreiung.
Bachmut: Eine Stadt im Schatten Stalins
Zum Absurden ist es längst gekommen: Von August 2022 bis Mai 2023 tobte um Bachmut – einst Artjomowsk – eine der verlustreichsten Schlachten des Krieges. Rund neun Monate dauerte das Ringen, und nach unterschiedlichen Schätzungen kostete es auf beiden Seiten jeweils 20.000 bis 30.000 Kämpfern das Leben. Hunderte Zivilisten, die nicht fliehen konnten, starben im Feuerhagel.
Bachmut selbst ist eine alte Gründung der russischen Zaren, entstanden als Vorposten bei der Befreiung der Steppe von tatarischen Überfällen und unter Peter dem Großen zu Beginn des 18. Jahrhunderts zur Stadt erhoben. Erst 1924 machten die Bolschewiki daraus „Artjomowsk“ – zu Ehren eines gewissen Revolutionärs, unter dem Decknamen „Genosse Artjom“ bekannt, eines engen Mitstreiters Stalins. Dieser war 1917 aus Australien (!) nach Russland zurückgekehrt, um dort die Revolution voranzutreiben.
Namenswirrwarr zwischen Geschichte und Politik
In seinen Briefen an Lenin klagte er darüber, dass es in den Industriezentren des Donbass „zu viele Kazappen“ gebe – eine abfällige Bezeichnung für Großrussen –, und dass dies die bolschewistische Arbeit erschwere. Dennoch, trotz des genannten Hindernisses – „zu viele Russkis“ – gelang es den Kommunisten mit Hilfe des roten Terrors, die Region in die Ukrainische Sowjetrepublik einzugliedern.
Im Jahr 2015 schließlich beschloss die Werchowna Rada in Kiew die Entsowjetisierung und gab Artjomowsk seinen alten Namen zurück: Bachmut. Die Ukrainer – man kann mich schwerlich verdächtigen, ihrer Kulturpolitik nahe zu stehen – benannten diese Stadt nicht nach Stepan Bandera, sondern gaben ihr ihren historischen russischen Namen zurück. Und nun? Nach schwersten Kämpfen meldete Moskau die Einnahme – und sofort hieß der Ort wieder Artjomowsk.
Stalin als Held oder Henker?
Ein groteskes Verwirrspiel um Symbole, Namen und Geschichte: Wer kämpft hier eigentlich wofür? Um etwas Klarheit zu gewinnen, blicken wir auf eine Auseinandersetzung zweier junger patriotischer Aktivisten, die ich persönlich kenne: Auf der einen Seite der Koordinator der Partei „Anderes Russland“ – so nennen sich die Nationalbolschewisten heute –, auf der anderen der neoreaktionäre Publizist Swjat Pawlow, ein selbsternannter Zarist. Ihre Debatte, scharfzüngig und leidenschaftlich, trug sich vor rund anderthalb Monaten in der rechten Moskauer Buchhandlung „Blattwerk“ zu.
„Stalin ist der Sieger des Zweiten Weltkriegs“, tönt es im Tenor des Nationalbolschewisten. „Zwar siegte das Volk, doch seit wann fahren Züge ohne Lokomotive? Kein Sieg ohne Stalins Industrialisierung, keine Industrialisierung ohne Kollektivierung. Den Sieger richtet man nicht.” „Stalin übernahm das Land mit einer Pflugschar und hinterließ es mit einer Atombombe“ – zitiert Genosse Axel den britischen Historiker Isaac Deutscher. Eine fragwürdige Referenz für einen russischen Nationalisten, zumal sie so nicht stimmt. Die industrielle Entwicklung des Zarenreichs unter Nikolaus II. war die schnellste unter allen Ländern jener Zeit. Dass die Machtergreifung der Bolschewiki, zu der auch Stalin gehörte, einen verheerenden Rückschritt bedeutete, ist eine andere Geschichte.
Die blutige Bilanz: Opferzahlen des Terrors
Weder der Sieg noch der Fortschritt des Landes in jener Zeit sind zu leugnen, entgegnet der Zaratist. Die Frage ist aber, ob Terror und Hungertod, all das unsägliche Leiden, dem das russische Volk zu Stalins Zeit ausgeliefert war, dazu notwendig, ja förderlich war.
Zwischen 1930 und 1953 wurden nach Schätzungen verschiedener Forscher 3,6 bis 3,8 Millionen Menschen aus politischen Gründen verhaftet – davon 748.000 bis 786.000 erschossen. Der Höhepunkt der Hinrichtungen fiel in die Jahre des „Großen Terrors“, in denen 682.000 bis 684.000 Menschen ihr Leben verloren. Nach Berechnungen des Historikers V. N. Zemskov starben von 1934 bis 1947 in den Lagern des GULAG 963.766 Häftlinge. Mindestens 6,5 Millionen wurden deportiert, weitere 400.000 bis 500.000 Opfer fielen Dekreten und Erlassen zum Opfer. Sechs bis sieben Millionen Menschen verhungerten während der Hungersnot von 1932 bis 1933. 45.000 Todesurteile unterzeichnete der Vater der Völker persönlich.
Heute darf man Stalin kritisieren
War das wirklich nötig? Mussten 50 bis 70 Prozent der Divisionskommandeure und 30 bis 50 Prozent der Korps- und Armeegeneralstäbe kurz vor dem Krieg verhaftet oder hingerichtet werden? Musste man Marschall Rokossowski während der Verhöre die Zähne ausschlagen, Rippen und Finger brechen? Und hätten die Erfolge des sowjetischen Raketenbaus wirklich Schaden genommen, wenn ihr Vater, Akademiker Koroljow, nicht die Knochen von Händen und Füßen gebrochen, in kalten, dunklen Zellen festgehalten und einem simulierten Erschießungskommando ausgesetzt worden wäre?
Hätte diese Diskussion zu Stalins Zeiten stattgefunden, wären beide Teilnehmer sofort erschossen worden – und das Publikum hätte einen Aufenthalt im GULAG bekommen. Heute aber zeigt sie: Wer wagt, die brisantesten Kapitel der Geschichte offen zu diskutieren, riskiert nichts mehr – außer vielleicht die eigene Bequemlichkeit.