FREILICH: Herr Wolfschlag, in Ihrem Kaplaken-Band Linke Räume skizzieren Sie, zugespitzt formuliert, einen architekturideologischen Komplex, der unter dem Deckmantel des Antifaschismus aktiv gegen schöne Stadtbilder und Rekonstruktionsprojekte in Deutschland vorgeht. Nun geraten die politischen Verhältnisse in Deutschland langsam ins Wanken. Gilt das auch für die linken Räume in der Architektur, die Sie in Ihrem Buch beschrieben haben?
Dr. Claus Wolfschlag: Zuerst: Noch sehe ich die politischen Verhältnisse in Deutschland nicht am Kippen. Es gibt wohl seismische Erschütterungen und einen schrittweisen Verfall etablierter Strukturen, aber dass da etwas fällt beziehungsweise sich grundlegend ändert, erkenne ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht. Es wird stattdessen von Seiten der Regierenden derzeit alles festgezurrt, um mittels Propaganda, sanfter Zensur und behördlichem Vorgehen, die bestehenden Machtverhältnisse noch für längere Zeit abzusichern. Wenn also in diesen Bereichen derzeit noch kein entscheidendes Wanken feststellbar ist, zeichnet sich das auch nicht für den Bereich der Architektur aus.
Dort herrschen derzeit ganz andere Probleme, um welche die Gedanken der Planer kreisen: die energetische Sanierung der Bestandsgebäude. Der massive Wohnungsbau, um diejenigen mit Wohnraum zu versorgen, die neu zu uns kommen. Die steigenden Energie- und Materialkosten, der Handwerker-Mangel, die gestiegenen Bauzinsen. Bei so vielen Sorgen bleibt in den Köpfen wenig Platz, sich Gedanken um schönere Stadtbilder zu machen, auch wenn das eigentlich gar nicht so schwer wäre. Dass sich das eines Tages ändern wird, davon gehe ich aber aus.
In der Ende April bei Antaios erscheinenden, von Ihnen herausgegebenen Anthologie Meinung, Pranger, Konsequenzen geht es grob gesagt um „Cancel Culture“. Wird in der Architekturszene anders oder besonders heftig gecancelt? Aus der Kulturszene gab es doch immer wieder besonders krasse Beispiele. Man denke nur an die Sängerin Ronja Maltzahn, die wegen ihrer Dreadlocks nicht auf einer Demo von Fridays for Future spielen durfte.
Mir wäre nicht bekannt, dass in der Architekturszene besonders heftig gecancelt würde. Ich bin allerdings auch nicht Architekt, kann das somit nur von außen bewerten. Es gibt natürlich Mobbing-Vorstöße in diesem Bereich, zum Beispiel als es 2015 an der HfG Karlsruhe einen Aufruf „Gegen die Salonfähigkeit Neuer Rechter“ gab, der sich gegen den wissenschaftlichen Mitarbeiter Marc Jongen richtete, ein AfD-Mitglied. Oder zum Beispiel der Stuttgarter Professor Stephan Trüby, der publizistisch gegen den Modernismus-kritischen und angeblich „ultrakonservativen“ Frankfurter Architekten Christoph Mäckler schoss. Zudem gibt es im Internet Berichte von Architektur-Studenten, die schildern, bei der Lehre und Umsetzung traditioneller Bauentwürfe behindert worden zu sein. Das sind auf der politischen Ebene aber Probleme, die derzeit auch in anderen Fächern und Hochschulen auftreten.
Schon in den späten 80ern und frühen 90ern konnte man als Student von Professoren unter Druck gesetzt werden, Aussagen und Quellenauswahl in ansonsten fachlich korrekten Hausarbeiten entweder zu verändern oder eine schlechtere Note zu riskieren. Das wurde auch recht offen kommuniziert. Heute hat sich die „Cancel Culture“ natürlich sehr ausgeweitet. Da reden wir gar nicht mehr von den Studenten, sondern sogar von Professoren, die massiv bedroht und gemobbt werden, wenn ihre Position zu deutlich vom offiziellen Mainstream abweicht. Denken sie an die Fälle von Jörg Baberowski, Martin Wagener oder Susanne Schröter. Zum Schutz solcher Freigeister hat sich ja das „Netzwerk Wissenschaftsfreiheit“ gebildet.
Zurück zur Architektur: Abseits der Universitäten und öffentlichen Aufträge entscheidet letztlich der Markt. Wenn man Bauherren findet, die die Finanzierung stemmen, dann kann man vieles bauen. Der luxemburgische Architekt Leon Krier berichtete mir einmal, dass er nach seiner öffentlichen Kritik an der modernistischen Architektur keine Chance mehr bei öffentlichen Aufträgen hatte.
Prince Charles wurde dann aber auf Krier aufmerksam, sodass zwischen beiden eine Kooperation entstand. Das war natürlich ein Glücksfall. Der Architekt Rüdiger Patzschke erzählte mir 2018, dass er nach der Fertigstellung des traditionell gestalteten Hotels Adlon in Berlin am Brandenburger Tor erst einmal kaum noch Aufträge erhalten hätte. Das kann dann existenzbedrohend werden.
Im Osten Deutschlands überlebten in der DDR viele schöne Altstädte, Bürgerhäuser und Dorfbauten. Nach der Wende kümmerten und kümmern sich immer noch oft lokale Bürgerinitiativen um den architektonischen Wiederaufbau. Sie haben selbst Erfahrungen mit von Bürgern vorangetriebener Rekonstruktion. Sehen Sie eher darin die Zukunft oder könnte auch eine neue, nicht-linke Regierung unsere Städte schöner machen?
Der Osten Deutschlands war insofern ein Glücksfall, als die DDR-Führung aus ökonomischem Unvermögen nicht in dem Maß abreißen konnte, wie sie eigentlich wollte. Denn der Modernisierungseifer war dort durchaus ja auch stark vorhanden. Und dann kam die Wiedervereinigung und das westliche Geld, mit dem die maroden Altstädte in letzter Sekunde gerettet werden konnten. Hätte es zehn Jahre länger gedauert, hätten die SED-Genossen nichts mehr abreißen müssen, denn es wäre alles von selbst zusammengefallen – um es mal etwas salopp auszudrücken.
Bürgerinitiativen sind bei baulichen Projekten eher eine Notlösung. Sie entstehen, weil die politisch Verantwortlichen kein Interesse an einer Stadtbildreparatur und an Rekonstruktionen haben. Bürgerinitiativen können schon aufgrund ihrer begrenzten Ressourcen nur punktuell etwas bewirken. Zudem werden sie dabei noch regelmäßig stark beschossen. Das war in den letzten Jahren bei den Attacken gegen Rekonstruktionen durch einige linke Architekturtheoretiker wie Stephan Trüby oder Philipp Oswalt zu sehen. Es wird mit Dreck geworfen, in der Hoffnung, dass davon genug kleben bleibt.
Dass eine nicht-linke oder eine Regierung mit einem ästhetischen Bewusstsein natürlich in ganz anderem Umfang Stadtverschönerungsprogramme durchsetzen kann, zeigt das Beispiel Ungarn. Dort werden gerade zum Beispiel im Rahmen des Nationalen Hauszmann-Programms zahlreiche Rekonstruktionen von Großbauten in Budapest durchgeführt.
Wenn wir schon von Architekturpolitik sprechen: Was wäre eigentlich die „konservative“ Alternative zu den einheitlichen Blöcken aus Glas und grauem Beton, die derzeit wieder allerorts aus dem Boden sprießen? Barock, Jugendstil, Biedermeier? Oder doch das gute, alte Fachwerk? Was für Altstadtausflüge schön ist, könnte sich für viele Menschen im Alltag doch zu sehr nach Museum anfühlen. Und kann man die Ästhetik, besonders bei größeren Wohnprojekten, überhaupt hoch und die Kosten dennoch niedrig halten?
Bei der Frage nach einer künftigen Architektur-Alternative kann man keine Einheitsschablone anwenden. Die konservative Alternative besteht ja gerade darin, sich mit den Besonderheiten und Einzigartigkeiten von Orten auseinanderzusetzen. Letztlich geht es dabei erst einmal um eine Rückgewinnung von Bewusstsein und von traditioneller Bauweise, also in der Proportionslehre, im Bemühen um Einpassung und Ensemblewirkung, in der Wiederentdeckung des Ornaments und der geschichtlichen Bezüge. Schöne Fassaden sind übrigens nicht so teuer, wie mancher denkt.
Ich höre immer wieder, dass eine aufwändige Fassade etwa zwei Prozent der Gesamtbaukosten ausmachen würde. Umgelegt wäre das bei einer Miete von 1500 Euro ein monatlicher Mehrpreis von 30 Euro. Aber ein heutiger Bauherr sagt sich vermutlich, dass er für diese zwei Prozent ja Kosten spart und sich dafür einen neuen SUV kaufen kann – zumal die Käufer und Mieter ohnehin alles nehmen, was ihnen hingestellt wird. Ganz abgesehen davon, dass Architekten erst mal wieder lernen müssen, harmonisch gestaltete Fassaden zu entwerfen.
Wir sprachen gerade schon über das in der DDR in Teilen „eingefrorene“ Städtebild Ostdeutschlands. Im Westen hingegen kamen mit dem Wirtschaftswunder auch brutalistische Kirchen, die bisweilen eher an Sci-Fi-Drehorte denn an sakrale Einkehrorte erinnern und unzählige schmucklose, graue Verwaltungs-, Bildungs- und Geschäftsbauten. Verantwortet hatten das in der Nachkriegszeit auch Konservative.
Dann müssten wir die Frage klären, was denn konservativ ist? Ist der bräsige CSU- oder ÖVP-Stadtrat, dem es nur um die Stadtkasse, um die Neuansiedlung von Gewerbeparks und Wellness-Hotels geht, wirklich konservativ? Oder lässt der Konservative nicht den Materialismus zumindest ein Stück weit hinter sich, um sich eine spirituelle Ebene zu erschließen? Denkt der wahre Konservative an irgendwelche Investorenarchitektur, die, nachdem sie 30 Jahre ihren Zweck erfüllt hat, wieder abgerissen wird, um von einer ähnlichen Belanglosigkeit ersetzt zu werden und um die Bauwirtschaft anzukurbeln? Oder denkt er an etwas, das lange über ihn hinausreicht?
Ist es der Luxus der Nachkriegsgenerationen, darüber klagen zu können, dass man beim Wiederaufbau des zerstörten Deutschlands auf Pragmatismus statt Geschmack setzte? Oder kam diese Baupolitik daher, dass man sich sagte, dass auch schön zu bauen nach Auschwitz barbarisch sei?
Auschwitz muss, wie fast immer, vor allem zur Legitimation von irgendwelchen ganz anderen Interessen und Plänen herhalten. Das ist wie ein säkularisierter Gotteswille. Früher hat man alles Mögliche damit begründet, dass Gott es eben so will oder gewollt haben dürfte. Heute wird Auschwitz als Grund für alles Mögliche herangezogen, von der Bombardierung Belgrads oder der Einnahme Bagdads bis zur Legitimation von hässlichen Häusern.
Doch stimmt das Bild nicht, dass die hässlichen Städte Ergebnisse der unmittelbaren Nachkriegszeit wären. Die ersten Jahre nach dem Krieg hat man durchaus noch geschmackvoll gebaut. Viele traditionell arbeitende Architekten waren noch aktiv. Im Westen wurden Wiederaufbauprojekte wie der Prinzipalmarkt in Münster umgesetzt; in der DDR entstanden immerhin neoklassizistisch inspirierte Ensembles in der „nationalen Tradition“. Zehn Jahre nach dem Krieg aber hatten die Modernisten sämtliche Schlüsselstellungen übernommen.
Der Architekturtheoretiker Norbert Borrmann schrieb 2013 in „Die große Gleichschaltung“, dass ab Mitte der 1950er-Jahre die Modernisten unter sich waren. Das heißt, sie beherrschten die Lehranstalten, die Kommissionen, die Fachorgane. Die baulichen Auswüchse wurden dann bis zum Ende der 1970er-Jahre immer schlimmer, von Neue Heimat-Zeilenbau bis Plattenblock und Banlieue. Erst die Hausbesetzerszene, der Denkmalschutz und die Postmoderne setzten dem ein vorläufiges Ende. Bis dann das modernistische Roll-Back stattfand, das in die praktischen weißen Dämmwürfel heutiger Tage mündete, die so wunderbar zu den Energieeffizienz-Plänen der „grünen“ Politik passen.
Die wirklichen Ursachen der Bau-Misere liegen also weder in Auschwitz noch im Nachkriegs-Pragmatismus. Es geht um das Vergessen der Herkunft und die Bindung an die Tradition. Es geht um die Auflösung historischer Traditionen. Es geht um die Emanzipation des so freien, kreativen Geistes, die schon das historische „Bauhaus“ propagierte. Hierbei ging sehr viel Wissen verloren. Wohin diese Emanzipation geführt hat, können wir an unseren Stadtbildern ablesen. Was dort an Schönem und Sehenswertem zu erkennen ist, stammt – natürlich von Ausnahmen abgesehen – im Großen aus der Zeit vor Gropius und Mies van der Rohe. Das war wohl doch nichts mit der Befreiung der Kreativität.
Herr Wolfschlag, vielen Dank für das Gespräch!
Zur Person:
Dr. Claus Wolfschlag ist deutscher Politologe und Publizist und gehört zu den Stammautoren der Wochenzeitung Junge Freiheit.
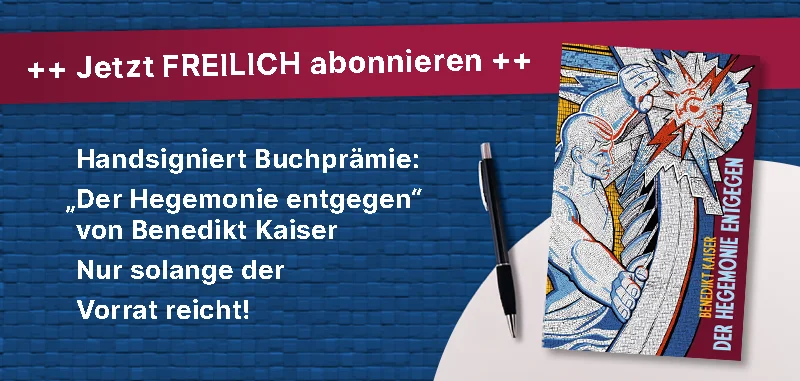




Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!