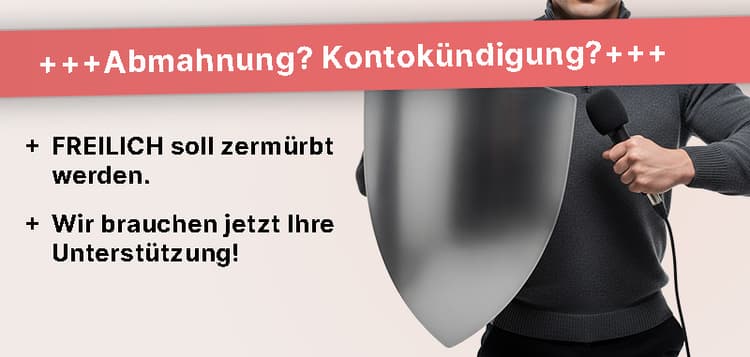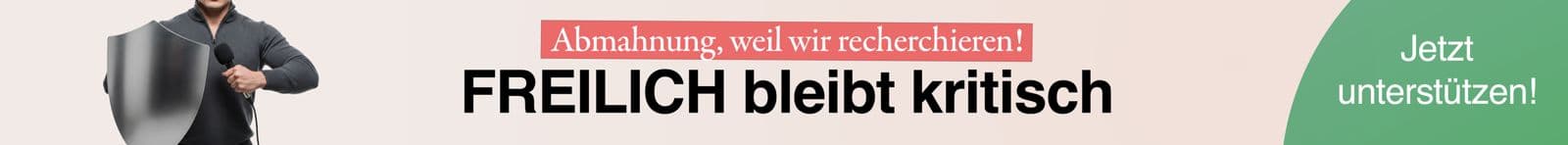Niemandem an den Hals werfen: Zum geopolitischen Richtungsstreit in der AfD
Der außenpolitische Richtungsstreit blockiert die AfD stärker, als es die realen Gegensätze rechtfertigen. Wie Florian Sander betont, fehlt es vor allem an der Fähigkeit, andere Positionen auszuhalten.
Kaum regiert Donald Trump wieder, kaum hat man als Partei etwas Nähe zu Washington aufgebaut, so kommt es wieder auf: Der alte innerparteiliche Zwist zwischen transatlantischen „Trumpisten“ und russlandfreundlichen „Putinisten“. Von „Neokonservativen“ spreche ich hier bewusst nicht, denn dies wäre eher Polemik als wahrheitsgemäße Semantik: Neokonservative im korrekten Sinne des Wortes (d. h.: militant-liberale Demokratie-Verbreiter) gibt es heute eher bei Grünen und FDP; in der AfD ist dies mit den Austritten Luckes und Petrys einigermaßen passé. Was es freilich gibt, sind Anhänger des MAGA-Trumpismus: Manchmal libertär, sicherlich „paläokonservativ“ im US-amerikanischen Sinne, also interessenorientiert-kapitalistisch. Demgegenüber stehen Anhänger eines Bündnisses mit Russland und, zwischen diesen Polen, viele, die im Sinne Bismarckscher Realpolitik auf friedliche Koexistenz mit beiden Großmächten setzen. Bedauerlich ist bei alldem aus der Sicht des Autors dieser Zeilen, dass das angestrebte Verhältnis zu China oft so im Unklaren bleibt, obwohl es doch mindestens genauso wichtig wäre, auch hier eine friedliche Koexistenz und Partnerschaft sicherzustellen. Doch dazu mehr an anderer Stelle.

Andere Meinungen endlich aushalten
Als relativ kühl-analytischer Beobachter dieser Frage hat man zuweilen den Eindruck, als redeten beide Seiten im Zuge eines typisch deutschen Hineinsteigerns in eine dieser Präferenzen (wie man es auch von manchen Befürwortern der israelischen Regierungspolitik kennt) aneinander vorbei. Man will – gerade als jemand, der sich wie der Autor dieser Zeilen sowohl als antiimperialistischer Befürworter einer Partnerschaft mit Russland und China, aber auch als Freund des amerikanischen Wesens und der nationalen Interessenpolitik der Trump-Administration begreift – zurückfragen: Wo seht ihr denn eigentlich die Widersprüche?
Einen ganz dringenden Verbesserungsbedarf gäbe es freilich auf beiden Seiten der innerparteilichen Debatte: Man könnte zum Beispiel einmal damit anfangen, Vertreter der Gegenseite nicht immer gleich aus der Partei werfen zu wollen. Das betrifft sowohl Auslandsreisen zwecks diplomatischer Gespräche, aber eben auch Parteifreunde an der Basis, die sich mit der Sache der Ukraine gemein gemacht haben. Zugegeben: Wenn nun ironischerweise ausgerechnet Personen wegen politischen Gesprächen in Russland innerparteiliche Ordnungsmaßnahmen drohen, welche zuvor im Zuge landesverbandlicher Vorstandsämter selbst versucht haben, wiederum andere wegen pro-ukrainischer Aktivitäten aus der Partei zu werfen, so mindert dies die persönlichen Mitleidsgefühle des Autors dieser Zeilen in nicht unerheblicher Weise. Und doch ist die Frage zu stellen: Muss das denn alles sein? Sollte es in einer Volkspartei neuen Typs wie der AfD nicht möglich sein, über diese außenpolitischen Grenzen hinweg miteinander im Diskurs zu bleiben, ohne immer wechselseitig die Gegenseite irgendwelchen obskuren Strafmaßnahmen unterziehen zu wollen? Wie schwach müssen die eigenen Argumente sein, wenn man andere Positionen so wenig aushalten kann?
Verhandlungsmacht statt Katzbuckelei
Etwas weniger politische Naivität an anderer Stelle wiederum würde man sich zuweilen auch wünschen: Diplomatische Gespräche sind eben als solche noch nicht „an sich“ gut. Einfach nur ein „wir reden jetzt mal“ und „hey, immerhin haben wir uns getroffen und nett geredet“ beendet keine Kriege. Diplomatie und Verhandlungen funktionieren nur, wenn man ein klares Ziel und vor allem auch Verhandlungsmacht hat, wenn man also etwas „im Gepäck“ hat – sei es ein positiver Anreiz oder eine Drohkulisse, Zuckerbrot oder Peitsche. Hier möchte man die Russland-Reisenden offen und ehrlich fragen: Was hattet ihr denn im Gepäck, außer schönen Worten? Etwas, was AfD-Politiker gegenüber russischen Würdenträgern, bei aller Diplomatie und bei aller Relevanz der friedlichen Koexistenz, jedenfalls nicht mehr im Gepäck haben sollten, sind Katzbuckeln und Ehrerbietung anlässlich des Tages der deutschen Niederlage – schon gar nicht gegenüber Leuten, die öffentlich in russischen Medien von Atombombenabwürfen auf Berlin fabulieren. Es gibt einen Unterschied zwischen diplomatischer Annäherung und eigener Entwürdigung, und Alice Weidel hat Recht, wenn sie dies deutlich kommuniziert.
Doch auch die „Transatlantiker“ erliegen einem Irrtum, wenn sie nun allzu plump die Abkehr von Russland und China zugunsten einer Hinwendung gen Westen propagieren, denn dieser liegt ein wesentlicher Denkfehler zugrunde: Das Ausblenden der demokratisch bedingten Kurzlebigkeit US-amerikanischer außenpolitischer Doktrinen. Da in den USA, anders als es einem hier pausenlos weisgemacht werden soll, im Gegensatz zur BRD der demokratische Wettbewerb einigermaßen funktioniert, wie man an den zumindest im außenpolitischen Bereich grundverschiedenen programmatischen Angeboten der beiden großen US-Parteien sehen kann, kann sich dort im Zuge einer Präsidentschaftswahl eben der politische Wind um 180 Grad drehen, wie wir Anfang dieses Jahres erst gesehen haben.
Demokratien sind wankelmütig
Die Vernunft gebietet angesichts dieser politisch-institutionellen Bestandsaufnahme zu fragen: Wäre es angesichts dieser Kurzlebigkeit nicht angemessen, sich, anstatt sich sofort der amerikanischen Supermacht „an den Hals zu werfen“, lieber auf ein nüchtern-pragmatisches, realpolitisches Verhältnis gegenseitiger und vor allem gleichberechtigter Wertschätzung hinzuarbeiten? Bereits jetzt zeigen sich in der – ja durchaus begrüßenswerten – politischen Vorherrschaft der Grand Old Party in den USA erste Risse: New York ist ein Beispiel. Und wer immer als republikanischer Präsidentschaftskandidat auf Donald Trump folgen wird: Er wird es 2028 möglicherweise mit einer deutlich härteren demokratischen Konkurrenz zu tun bekommen als sie Kamala Harris oder gar Joe Biden aufbieten konnten. Ein Gavin Newsom etwa ist charismatisch, politisch und rhetorisch geschickt und „präsidiabel“ – mit anderen Worten: Die ganze hübsche transatlantische Partnerschaft zwischen amerikanischen und europäischen Konservativen könnte in wenigen Jahren schon wieder, wenn auch nicht vergangen, so doch regierungspolitisch bedeutungslos sein (eine Kurzlebigkeit, von der man in Moskau und Peking hingegen nicht unbedingt ausgehen sollte). Was also ist dann? Welche Partner bleiben dann noch?
Wer auch immer sich wem auch immer allzu schnell geopolitisch an den Hals werfen möchte, lässt es allzu häufig an der nötigen realpolitischen Kühle vermissen. Dabei vermittelt diese eben eine wichtige Erkenntnis: Die eine Seite steht der anderen Seite doch eigentlich gar nicht im Wege. Die amtierende US-Regierung betrachtet den Krieg zwischen Russland und der Ukraine als eine „regionale“ Auseinandersetzung; mit anderen Worten, sie weigert sich, diese, wie dagegen die Biden-Administration, als geopolitischen Austragungsort eines globalen Systemkonflikts anzusehen. Man mag darüber streiten, wie zutreffend diese Sichtweise ist, zumal es auch davon abhängig ist, welcher US-amerikanischen konservativen Unterströmung man denn folgt: Neokonservative (wie Bolton und Co.) befinden sich seit Jahrzehnten die ganze Zeit in globalen Systemauseinandersetzungen, während Paläokonservative (wie Bannon, Miller oder Taylor Greene) mit Demokratien wie auch Autokratien Freundschaft schließen können, solange diese nur nicht islamistisch sind oder, wie Venezuela, US-amerikanischen Wirtschaftsinteressen entgegenstehen.
Es geht um Augenhöhe
Für uns entscheidend jedoch – das sollte (!) uns in der AfD eigentlich alle einen – ist eben die deutsche Perspektive. Und wissen Sie, was das Schöne bei alldem ist? Die Trump-Paläokonservativen (im Gegensatz zu den Bush-NeoCons vor 20 Jahren) verstehen das! Sie gehen eben von der realistischen Prämisse aus, dass jedes Land seine Interessen hat, und eben darauf fußt der Gedanke des „Dealmaking“ (als realpolitisches Gegenprogramm zum neokonservativen „Regime Change“, der 2003ff. den Irak überzog und zerstörte). Heutige US-Konservative verstehen im Gegensatz zu den damaligen, dass auch Partner der USA ihre eigenen Interessen haben, und sie sind deswegen nicht mehr beleidigt (wie es noch ein Donald Rumsfeld war, als er von „Old Europe“ sprach). Und genau deswegen wäre es ein veraltetes, typisch deutsch-transatlantisches Verständnis im Altparteien-Stil zu glauben, man müsse sich den USA nun wieder an den Hals werfen, um mit den dort aktuell (!) Regierenden klarzukommen. Das müssen wir nicht. Wir müssen auf Augenhöhe kommen.
Mit anderen Worten heißt das: Wir können beides tun. Wir können deutsche Interessenpolitik betreiben, wir können uns mit Russland gut stellen, wir können eine nicht nur ökonomische, sondern auch politische Partnerschaft mit China in die Wege leiten, und wir können trotzdem mit den Konservativen der USA zusammenarbeiten, sowohl wenn sie regieren, als auch, wenn sie einmal wieder nicht mehr regieren. Denn, und damit kommen wir auf eine der oben genannten Erkenntnisse zurück: Gerade durch solche Verbindungen zu beiden Himmelsrichtungen haben wir dann eben etwas „im Gepäck“, gerade dadurch haben wir Verhandlungsmacht, und gerade das zeichnet wahrhaft souveräne Außenpolitik aus. Wir lassen uns von niemandem vereinnahmen, wir werfen uns niemandem einfach an den Hals, wir bewahren unseren Stolz und unsere Würde – und wir werden gerade dadurch zu einem gefragten Mittler zwischen Ost und West. Haben wir diese Rolle erst verinnerlicht, so haben wir dann auch die innere – innerparteiliche – Souveränität, nicht gleich immer jeden aus der Partei werfen zu wollen, der mal etwas anders sieht.