Karlheinz Weißmanns neues Buch füllt tatsächlich „eine Lücke“, nämlich die Lücke zwischen den meist mit Blick auf ihre Regierungstätigkeit beschriebenen Mitte-Rechts-Parteien und den heutzutage meist pauschal ins rechtsextreme Eck gestellten oppositionellen Kräften von rechts (die Weißmann dann noch einmal unterteilt in „Ultras“ und „nationale Opposition“). Weißmann nimmt damit publizistisch das ein, was der Linken politisch besonders missfällt, weil es das für sie gefährlichste ist, nämlich eine „Scharnierfunktion“ zwischen „schwarz-gelb“ (im bundesdeutschen Sinn von CDU und FDP!) und blau, ohne Rücksicht auf Berührungsängste und „political correctness“.
Die rechte Scharnierfunktion zwischen CDU und Opposition
Weißmanns Darstellung hilft auch die weinerliche Legende zu dekonstruieren, die alle Probleme der deutschen Rechten auf das fatale NS-Regime und das Ende des Reiches im Jahr 1945 zurückführt. Denn weder der Begriff „rechts“ noch das Etikett „national“ galten in den fünfziger Jahren als kontaminiert. Dafür konnte die Bundesrepublik in einer anderen Hinsicht als Sonderfall gelten: Denn ihre dominante Partei, die CDU, bestand – wie Weißmann prägnant formuliert – aus einer „Dauerkoalition“ des (katholischen) Zentrums und der (protestantischen) Konservativen der Vorkriegszeit (DNVP). Freilich: Durch Teilung und Vertreibung hatten sich die Gewichte verschoben. Die CDU wurde von Anfang an von Katholiken dominiert, die Nachfahren der preußischen Konservativen rangierten unter ferner liefen.
Es war kein Zufall, dass gerade in Weißmanns engerer Heimat Niedersachsen – als größtem mehrheitlich protestantischen Bundesland – noch lange Zeit andere Parteien mit einem starken regionalen Rückhalt der CDU dieses Spektrum streitig machten: Aus der alten Welfenpartei (die ursprünglich gegen die Annexion durch Preußen 1866 aufgetreten war) entstand die Deutsche Partei (DP), die in Niedersachsen auch den Ministerpräsidenten stellte. Eine der vielen aussagekräftigen Illustrationen in Weißmanns Buch ist zum Beispiel das Wahlplakat der DP von 1949: „Fahre rechts – bleibe rechts – wähle rechts“. Wie reagierte die CDU darauf? Adenauer war die Konkurrenz von rechts willkommen als Gegengewicht gegen die Linkskatholiken in den eigenen Reihen. Er koalierte mit ihr, überließ ihr Direktmandate – und „inhalierte“ sie auf lange Sicht. Ähnlich war der Umgang mit dem „Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten“ (BHE). Zum Unterschied vom Österreich der Großen Koalition wurde die BRD bis 1966 von einem „Bürgerblock“ regiert.
Was rechtsaußen zurückblieb, war eine Szene von Kleinparteien, die wie die Deutsche Reichspartei – ebenfalls mit Schwerpunkt im Norden – in einem ständigen Prozess von Spaltungen und Vereinigungen befangen waren – und nur ganz selten irgendwo die Fünfprozenthürde übersprangen. Die Vereinigung jedoch, die zu einer Gruppe hätte führen können, ähnlich wie sie in Österreich mit der FPÖ gegeben war, kam nicht zustande, nämlich die Fusion mit der FDP, die durchaus in der Tradition der Nationalliberalen stand. Berühmt wurde das Titelbild des Spiegel aus dem Jahre 1961, das ihren Obmann Erich Mende mit dem Ritterkreuz zeigte – was zwar nicht freundlich gemeint war, aber ihm zum (bis auf 2009) besten Wahlergebnis der Partei mit 13 Prozent verhalf.
Die CDU und die konservative Nachkriegslandschaft
Wenn man das Fazit aus dem Panorama zieht, das Weißmann präsentiert: Von all den unzähligen leidigen Eifersüchteleien einmal abgesehen, jegliche „nationale Opposition“ stand vor einem für sie offenbar unlösbaren Dilemma: Was der Rechten in den fünfziger und sechziger Jahren von der Großwetterlag her zwangsläufig Rückenwind verschaffte, waren der Antikommunismus und der „Kalte Krieg“. Es war die Linke, die angesichts der Bedrohung aus dem Osten unter Generalverdacht stand. Da war es zwar vielleicht herzerwärmend, aber politisch kontraproduktiv, wenn man pauschal gegen „die Alliierten“ polemisierte oder aus den Augenwinkeln mit einer Neutralisierung Deutschlands kokettierte, die vielleicht doch noch zu einer Wiedervereinigung führen könnte – dabei aber Gefahr lief, allen möglichen sowjetischen Störmanövern aufzusitzen.
Den Gedanken an die deutsche Einheit hochzuhalten, war ein hehres „metapolitisches“ Ziel, freilich ganz nach dem französische Motto über Elsaß-Lothringen vor 1914: „Immer daran denken, aber nicht davon reden.“ Denn Außenpolitik eignet sich nicht als Trennlinie für Parteien. Dazu ist sie eine Gleichung mit zu vielen Unbekannten. Bismarck hat es einmal so ausgedrückt: Man muss das Vorbeirauschen des Weltgeistes abwarten und den Zipfel seines Mantels erhaschen. Situationen wie die von 1989, als der Mauerfall plötzlich möglich wurde, lassen sich nicht herbeireden. Selbst ein der atlantischen p. c. so unverdächtiger Zeuge wie der klassische Rechtsintellektuelle Armin Mohler hat deshalb angesichts der Herausforderung durch die „68-er“ den Nationalen einmal ins Stammbuch geschrieben: „Warum nicht konservativ?“
Die Herausforderungen der nationalen Opposition
Eine deutsche Sonderentwicklung war die NPD unter der Führung von Adolf von Thadden, die im Zeichen der Großen Koalition und des Linksschwenks der FDP Mitte der sechziger Jahre eine Reihe überraschender Erfolge erzielte – eben als Gegenbewegung zu den „Achtundsechzigern“. Die NPD verfehlte 1969 mit 4,3 Prozent knapp den Einzug in den Bundestag – und schoss damit ironischerweise Willy Brandt den Weg ins Kanzleramt frei (denn CDU und NPD hatten zusammen mehr als 50 Prozent erzielt). Dass Brandt auch Kanzler blieb, lag hingegen an den Stasi-Geldern, mit denen beim konstruktiven Misstrauensvotum 1972 zwei Unionsabgeordnete zum Seitenwechsel bewogen wurden. Die Erbschaft der NPD-Wählerschaft aber trat nicht zuletzt Franz Josef Strauß an, der als „deutscher de Gaulle“ in einem neuen Anlauf alle Rechten in die Union integrieren wollte, während sein Rivale Helmut Kohl auf die Versöhnung mit dem Zeitgeist setzte, als „fleischgewordenes Godesberger Programm“ der CDU (in Anspielung auf die SPD, die auf ihrem Godesberger Parteitag 1959 ihr marxistisches Erbe zu entsorgen versucht hatte).
Als Kohl ab 1982 die versprochene Wende nicht einlöste, die Zuwanderung immer offenkundiger zu Problemen führte (und Strauß sich mit dem Milliardenkredit an die DDR eine Blöße gab), wurde auch Deutschland von dem internationalen Trend erfasst, der in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre vom Aufstieg „rechtspopulistischer“ Parteien geprägt war, von Le Pen und der Lega bis zu Haider. In Deutschland besetzten Schönhubers Republikaner diese Lücke. Wiederum entfaltete die „nationale Karte“ eine paradoxe, kontraproduktive Wirkung. Denn es war Kohl, der die Gelegenheit beim Schopf ergriff, die Wiedervereinigung unter Dach und Fach brachte – und dafür auch den Bonus kassierte. Der Rezensent erinnert sich an den Wahlabend 1990, als Kohl den Journalisten erklärte, das sei ein schöner Abend für ihn und die CDU – „und wenn ich mir Ihre Gesichter anschaue, meine Herren, ein besonders schöner ...“
Von der NPD zu rechtspopulistischen Strömungen
Was folgte, war für ein Vierteljahrhundert eine Variante der Geschichte Sherlock Holmes vom Hund, der nicht bellte. Während die Lega, die Alleanza nazionale, die FPÖ längst in die Ministerien aufgerückt waren, wurde die Szene rechts von der CDU/CSU von Mini-Parteien wie der NPD bevölkert, die schon deshalb nicht verboten werden konnte, weil ein so großer Anteil ihrer Spitzengremien aus V-Leuten des Verfassungsschutzes bestand. Erst die doppelte Krise, die sogenannte „EURO-Rettung“ und die sogenannte „Flüchtlingskrise“, führten im Nachholverfahren in der Ära Merkel 2013/15 dazu, dass mit der AfD auch in Deutschland eine rechtspopulistische Partei entstand, die keine Eintagsfliege blieb, sondern im „Osten“ inzwischen stärkste Kraft geworden ist – was unter europäischen Vorzeichen nichts anderem als einer Normalisierung Deutschlands gleichkommt.
Nicht unerwähnt soll bleiben, dass Weißmann das Gerüst der politischen Chronik immer wieder bereichert nicht bloß durch einen „Blick nach Österreich“, sondern durch Exkurse in die „Metapolitik“, mit ihrer kulturhistorischen Dimension, wie zum Beispiel die verschiedenen Spielarten der Jugendbewegung oder die politischen Symbole (ein Thema, dem er erst unlängst ein ganzes Lexikon gewidmet hat). Neben der konservativen Ökologie ist ein Abschnitt auch den Wanderern zwischen den Welten gewidmet, den „linken Leuten von rechts“, wie zum Beispiel Alain de Benoist, dem Begründer der französischen „Nouvelle Droite“, der eine antikapitalistisch angehauchte Kulturrevolution predigt, die jeder politischen Wende vorausgehen müsse.
Die AfD als Normalisierung und Wendepunkt
Weißmann hat der Versuchung widerstanden, am Schluss vom Chronisten zum Propheten zu mutieren. Belassen wir es bei einem Vergleich der Situation einst und jetzt. Das Problem besteht nicht darin, dass die CDU seit Kohls Zeiten oder auch schon früher opportunistisch handelt. Wie es in Österreich heißt: „Was, Travnicek, haben Sie sich denn erwartet?“ Das Problem ist, dass ihr Opportunismus längst inopportun geworden ist. Wenn immer wieder Strauß zitiert wird, rechts von der CSU dürfe es keine demokratische Partei geben, so meinte er eben nicht, dass man die Parteien, die es dort gibt, einfach als undemokratisch abqualifizieren sollte, sondern dass man sich um sie und ihre Wähler bemühen, sie integrieren und als „Hilfstruppe“ verwenden müsse. Ein Bündnis mit der AfD ist eine win-win Situation: Entweder die AfD benimmt sich vernünftig, dann ist es ein Erfolg – oder sie ist unvernünftig, dann erbt die CDU den Großteil ihrer Wähler – für beide Varianten gibt es jede Menge Beispiele in Europa. Die Pseudo-Eliten Deutschlands berufen sich ständig auf Europa – und missachten mit ihrer „Dextrophobie“ das Beispiel fast aller Partnerländer.
Der Thüringer CDU-Chef ließ unlängst verlauten: „Die CDU muss den Mut haben, Dinge zu sagen, die unter Strauß normal waren.“ Die Botschaft hör’ ich wohl, doch wie soll man daran glauben, wenn im Anschluss daran bloß die Frage diskutiert wird, welcher der linken Parteien man zuerst nachlaufen will?
Karlheinz Weißmann, Zwischen Reich und Republik. Geschichte der deutschen Nachkriegsrechten (Berlin 2024) 325 S. JF-Edition, € 39,90. Hier bestellen.
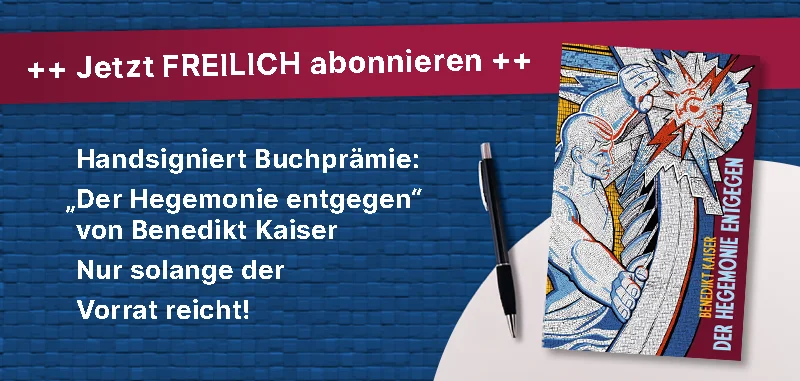


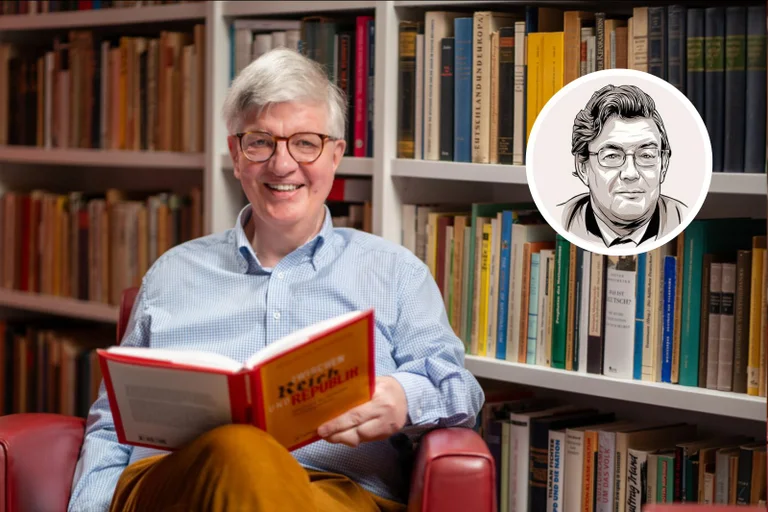


Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!