Die US-Regierung hat das EU-Establishment in den vergangenen Tagen in einen Schockzustand versetzt, als Trump nach einem Telefonat mit Putin ohne Einbeziehung der Europäer den Beginn von Friedensverhandlungen mit der Ukraine ankündigte. Schon vor Beginn der Verhandlungen scheint Washington über die Köpfe der Europäer hinweg dem Kreml zugestanden zu haben, die besetzten Gebiete behalten zu dürfen. Für die von Trump angestrebte Lösung dürfte die Ukraine auch nicht der NATO beitreten. Die Europäer sollen nach dem Willen Trumps künftig den Großteil der Hilfe für die Ukraine leisten, was im Umkehrschluss bedeutet, dass von Europa erwartet wird, mehr Lasten zu übernehmen, um die USA sicherheitspolitisch zu entlasten.
Trump will die Militärhilfe an die Ukraine aber unter der Bedingung fortsetzen, dass die Ukrainer dafür mit ihren Bodenschätzen bezahlen. Die ukrainischen Bodenschätze hatte Selenskyj bereits im Herbst als Teil seines „Plans für den Sieg“ angeboten. Doch nach Trumps Telefonat mit Putin verzichtete der ukrainische Präsident vorerst auf die Unterzeichnung eines Vertrags „Sicherheit gegen Rohstoffe“, den ihm US-Finanzminister Scott Bessent umgehend in Kiew vorgelegt hatte. „Das ist ein koloniales Abkommen und Selenskyj kann es nicht unterschreiben“, sagte ein ehemaliger hoher Beamter gegenüber der AP.
JD Vance in München: Kulturkampf statt Sicherheitspolitik
Nach dem Telefonat zwischen Trump und Putin schlug Washington auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz neue Töne an. In seiner Grundsatzrede auf der Sicherheitskonferenz warf US-Vizepräsident JD Vance die Frage auf, ob Europa und die USA noch genügend Werte teilten, um das gegenseitige Beistandsversprechen der NATO zu rechtfertigen. In seiner Rede, von der man eigentlich sicherheitspolitische Ausführungen erwartet hätte, ließ US-Vizepräsident JD Vance das Publikum wissen, dass die größte Gefahr für die Sicherheit Europas nicht aus Russland oder China komme, sondern von innen. Damit wollte er auf mangelnde Meinungsfreiheit und Zensur in Europa aufmerksam machen. Seine Zweifel an der demokratischen Gesinnung europäischer Regierungen und Gerichte untermauerte Vance mit Beispielen aus Rumänien und der Migrationskrise in Europa.
Vance nahm Anstoß an der Annullierung der Wahl in Rumänien. Seine Kritik an der Annullierung der Wahl in Rumänien war nicht aus der Luft gegriffen. Dass in Rumänien, einem EU-Mitglied, eine Präsidentschaftswahl mit fadenscheinigen Begründungen annulliert wurde, sei nun eine Tatsache. Die USA seien auch nicht bereit, Europa zu schützen, „wenn sie die grundlegenden Fragen ihrer Wähler nicht respektieren“. Zudem warnte Vance die Europäer davor, in „sowjetischer Manier“ von Desinformation zu sprechen, wenn ihnen etwas nicht passe. In diesem Zusammenhang kritisierte Vance die europäische Migrationspolitik, die ohne Rücksicht auf die Sorgen der einheimischen Bevölkerung betrieben werde. Im Vorfeld der Sicherheitskonferenz sagte er in einem Interview mit dem Wall Street Journal, dass die Weigerung, Migration einzudämmen, eine viel größere Bedrohung für die Demokratie darstelle als „Moskaus Einmischung in Wahlen“. Gleichzeitig forderte Vance Europa auf, mehr für die eigene Verteidigung zu tun. Denn die USA müssten sich „auf die Regionen der Welt konzentrieren, die in großer Gefahr sind“.
Dass die hiesige politische Klasse in Deutschland ganz anders denkt, zeigte die Eröffnungsrede von Bundespräsident Steinmeier, der sein Unbehagen über die Konzentration technologischer, finanzieller und politischer Macht in den USA artikulierte. Dazu passt auch, dass Vance und Scholz in München nicht miteinander sprachen. Für ein Treffen mit der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel hatte der Amerikaner in seinem Hotel noch Zeit.
Trump-Putin-Pakt: Bruch mit dem kollektiven Westen
Alles, was die Amerikaner in den letzten Tagen verkündet haben, ist ein Bruch nicht nur mit der bisherigen Ukrainepolitik, sondern mit der außenpolitischen Linie des kollektiven Westens. Vor allem steht bei einem möglichen Trump-Putin-Pakt die gesamte europäische Sicherheitsordnung auf dem Spiel. So will es jedenfalls die Kremlführung, die nach dem Telefonat zwischen Putin und Trump erklärte, im Dialog mit Trump müsse es darum gehen, „die Grundursachen des Konflikts“ in der Ukraine zu beseitigen. Putin denkt also geopolitisch und will Trump mit seiner Interpretation der „Grundursachen des Konflikts“ die Agenda des Gipfels diktieren. Setzt sich Putin in den Verhandlungen nicht durch, hat er einen Grund mehr, den Krieg fortzusetzen, auf den die russische Wirtschaft und Gesellschaft ausgerichtet sind. Man darf aber nicht vergessen, dass Trump kein Interesse daran hat, die Ukraine ganz fallen zu lassen. Würde sie dann von Moskau überrannt, stünde er nicht als starker Mann da.
Trump will über die Köpfe der Europäer hinweg mit der Kremlführung verhandeln und bricht damit mit dem Prinzip des kollektiven Westens, nach dem Europa und die USA bisher gemeinsam ihre Interessen gegenüber ihren Rivalen definiert haben. Mit der Forderung nach ukrainischen Bodenschätzen für Chips oder Elektroautos als Gegenleistung für Militärhilfe verändert Trump auch die Spielregeln in der Ukraine. Olaf Scholz machte in seiner Rede auf der Münchner Konferenz deutlich, dass man einen „Diktatfrieden“ in der Ukraine nicht akzeptieren werde. Vor diesem Hintergrund hat der französische Präsident Emmanuel Macron die EU-Staaten zu einem Krisengipfel nach Paris einberufen, der im Grunde als Gegengipfel zum bevorstehenden Treffen von Vertretern Russlands und der USA in Saudi-Arabien ohne Beteiligung der Europäer zu verstehen ist.
Trumps Annäherung an die Kremlführung beunruhigt China
Während der Westen sich selbst demontiert, beobachten die Rivalen der USA die Lage eher nüchtern. Inwieweit China vom Telefonat zwischen Trump und Putin überrascht wurde, ist unter Beobachtern umstritten. Chinesische Medien feiern bereits die „Rückkehr zum Realismus“ in der Welt. Die chinesische Zeitung Global Times lobte Trump dafür, dass er, Trump, „allmählich die regelbasierte Ordnung aufgibt“. Tatsächlich ist die chinesische Elite besorgt über die Annäherung zwischen Washington und Moskau. Dieser Ansatz wird allgemein als „Kissinger rückwärts“ bezeichnet: also der Versuch, Russland durch eine Annäherung an die USA von China zu lösen. Ähnlich wie der damalige Außenminister Henry Kissinger während des Kalten Krieges die Beziehungen zur Volksrepublik China normalisiert hatte, um die Sowjetunion zu isolieren.
Der Ukrainekrieg war ein geopolitischer Gewinn für China: Im Zuge des Ukrainekrieges wurde Moskau zum Juniorpartner Chinas degradiert und Peking konnte seine Machtbasis in Asien weiter ausbauen. Inwieweit Trump einen großen Deal auch mit Xi anstrebt, wird in China abgewartet. Xi hält sich derzeit in den Beziehungen zu den USA zurück und scheint froh zu sein, wenn Zölle und Drohungen andere Staaten treffen. Vor allem der Iran ist in Alarmbereitschaft. Ein Deal zwischen Putin und Trump würde die USA von einem Kriegsschauplatz entlasten, sodass Trump sich auf die Zerstörung des iranischen Atomprogramms konzentrieren könnte. Es ist durchaus möglich, die Ukraine zu opfern, um im Gegenzug die Zustimmung Moskaus zu erhalten, sich aus dem Nahen Osten herauszuhalten und die Konfrontation mit dem Iran zu eskalieren.
Trumps Europapolitik als Weckruf für die AfD
Die Trump-Administration irritiert aber nicht nur mit einer Überrumpelung der europäischen Verbündeten, deren Geschwindigkeit auch in Washington selbst zu einer gewissen Orientierungslosigkeit geführt zu haben scheint, sondern auch mit einer Einmischung in den deutschen Wahlkampf, wie es sie von amerikanischer Seite seit der sogenannten Entnazifizierung nicht mehr gegeben hat. In seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz sprach JD Vance eine Wahlempfehlung für die AfD aus, ohne die Partei zu nennen: „Es gibt keinen Platz für Brandmauern“, sagte er. Die Aufforderung der USA an die deutschen Parteien, mit der AfD zusammenzuarbeiten, bedeutet nicht automatisch, dass die Amerikaner für eine auf Deutschland bezogene, interessengeleitete Politik plädieren.
In der aktuellen geopolitischen Lage ist die Fragmentierung Europas eine Entwicklung, die den USA entgegenkommt, da Washington unter Präsident Trump jede Blockbildung gegen den US-Protektionismus aufbrechen will. Die Förderung einer europaskeptischen und gleichzeitig proamerikanischen Rechten (u. a. durch die Marginalisierung der völkischen Bewegung) hat für die USA enorme wirtschaftspolitische Vorteile, denn der EU-Binnenmarkt ist der größte Wirtschaftsraum der Welt. Wenn dieser Wirtschaftsraum zersplittert und von den Amerikanern kontrolliert wird, von lautstarken Regierungen, die im Grunde Trumps Vasallen sind, wird Europa nicht mehr in der Lage sein, zwischen den USA und China zu balancieren und sich als Pol auf der geopolitischen Landkarte zu behaupten. Über die Köpfe der Europäer hinweg über die Ukraine zu verhandeln, sollte ein Weckruf für die deutsche Rechte sein.
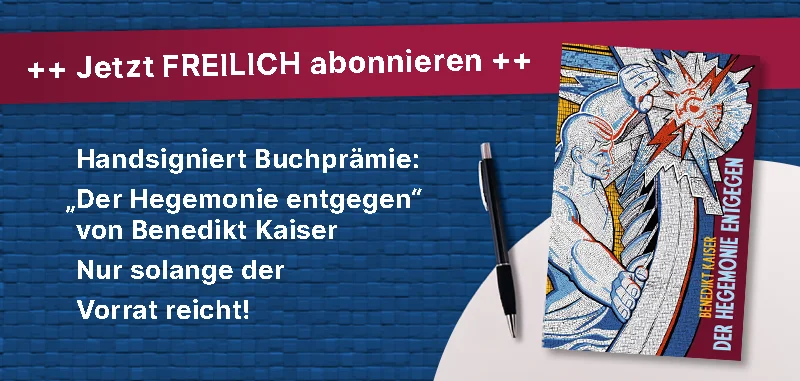
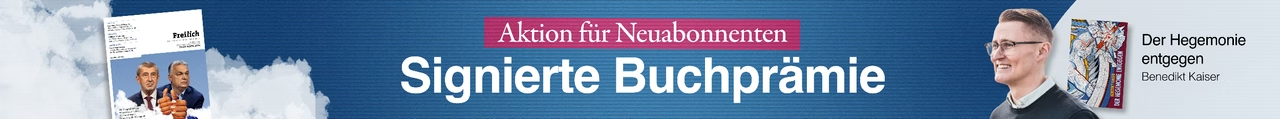


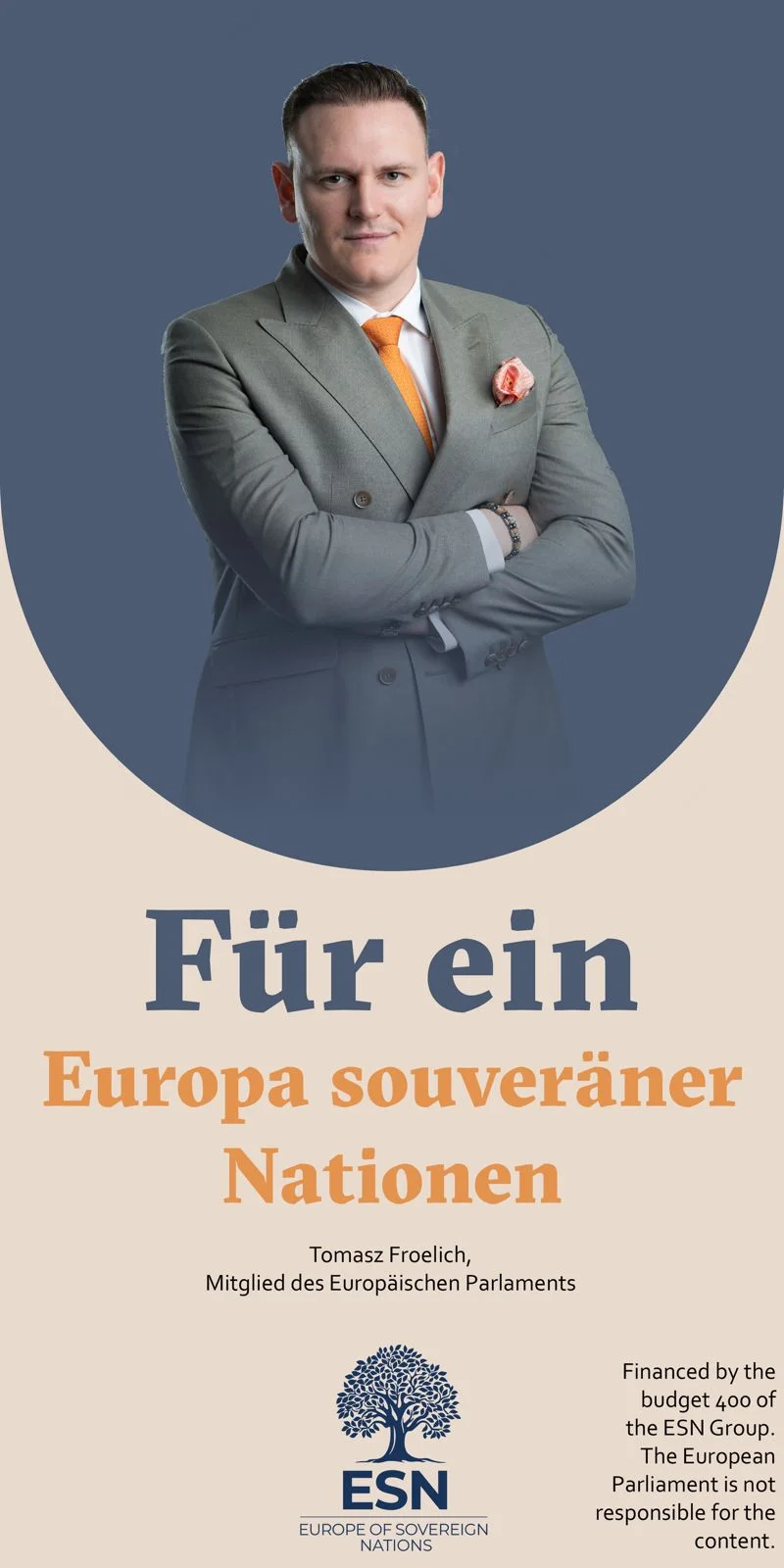

Kommentare
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!